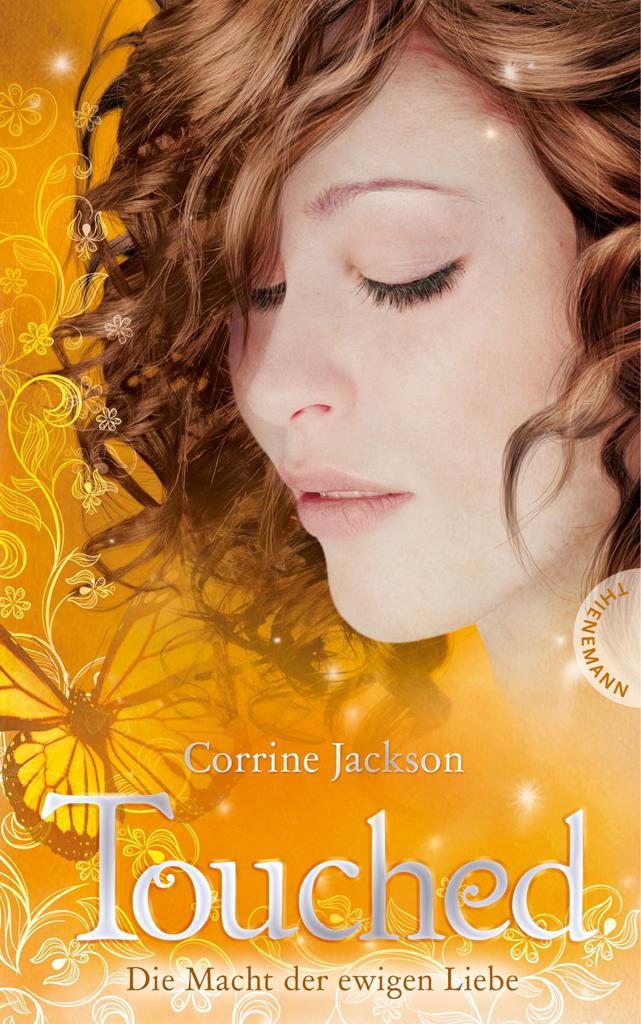![Die Macht der ewigen Liebe]()
Die Macht der ewigen Liebe
davon, dass sie stolz auf mich gewesen wäre. Mein Atem verfing sich, meine Brust tat weh, und ich konnte nur noch krächzen. Ich glaubte, Lucy hinter mir kichern zu hören, aber das war mir egal.
Der Anflug eines Lächelns zeigte sich um die Lippen meines Vaters, ehe er sie wieder zu einem geraden Strich zusammenpresste. »Deine Kräfte machen dich nicht verantwortlich für die ganze Welt. Du kannst nicht jeden retten. Und das erwartet auch keiner von dir.«
»Aber Laura …«
»… war die Liebe meines Lebens. Und ich weiß nicht, ob ich jemals aufhören werde, sie zu vermissen.« Seine Augen glänzten, und er räusperte sich. »Aber du hast sie nicht umgebracht. Also gib dir auch nicht die Schuld dafür. Das ist nicht fair. Weder dir noch Lucy noch mir gegenüber. Wir brauchen dich, Baby!«
Ich atmete tief ein, und als ich wieder ausatmete, war es, als würde ich auf einmal den ganzen Ballast über Bord werfen können. Ich hatte Angst, mein Vater würde mich hassen, doch so war es nicht. Er hatte recht, dabei wusste er nicht einmal, dass uns die Zeit davonlief. Wenn ich meine Familie schon nicht für immer haben konnte, dann doch immerhin jetzt. Zumindest so lange, bis sich die beiden genug erholt hatten, um heimkehren zu können.
Ich kletterte aufs Bett und setzte mich neben Dad, lehnte mich ans Kopfteil, genau wie er. Das erinnerte mich an eine Zeit, als wir glücklich gewesen waren: an den Morgen vor meiner Abschlussfeier. Ich legte den Kopf auf seine Schulter. »Ich brauche dich auch. Euch beide.«
Er atmete erleichtert auf, und sein Brustkorb hob sich. Lucy lümmelte sich am Bettende und schwang die Beine über meine. »Ist wirklich alles in Ordnung mit dir?«, fragte sie. »Asher hat gemeint, als du zu Franc auf Konfrontationskurs gegangen bist, wär’s ganz schön schaurig geworden.«
»Alcais hat auf mich geschossen«, sagte ich. Beide machten entsetzte Gesichter, und so beeilte ich mich, sie zu beruhigen. »Keine Bange, es ist alles okay mit mir.«
Mein Vater musterte mich lange genug, um zu erkennen, dass ich unverletzt war, und stupste Lucy mit einem Fuß an. »Wie hast du deine Schwester gleich immer genannt? Duffy?«
»Buffy, Dad, Buffy. Wie Buffy die Vampirschlächterin. «
»Ach Gott!« Dad machte ein entsetztes Gesicht. »Gibt es Vampire also wirklich?«
Lucys und mein Blick trafen sich. Unsere Lippen zitterten, dann prusteten wir beide los.
Mein Dad grinste. »Reingelegt!«
Sie fingen zu streiten an, und ich hörte ihnen einfach nur zu. Es war noch vieles ungesagt geblieben, und über die Zukunft war noch nicht gesprochen worden, aber fürs Erste schien es eine stillschweigende Übereinkunft zu geben, dass wir alles außerhalb dieses Augenblicks erst mal unberührt ließen.
Wir waren wieder eine Familie, und das reichte.
Ein Monat verging, in dem im Hause O’Malley nichts Nennenswertes geschah. Was in der Welt draußen passierte, stand allerdings auf einem ganz anderen Blatt. Die Polizei machte uns nie ausfindig. Die Morrisseys bekamen Wind davon, dass mein Großvater mit ihnen ein Doppelspiel getrieben hatte. Viel konnten sie deswegen nicht unternehmen, da Franc tot und Alcais verschwunden war. Seamus’ Spione fanden heraus, dass sie ihre Wut an Mark ausgelassen hatten, diesem Verräter, der gegen die Beschützer gearbeitet hatte. Bislang war seine Leiche allerdings noch nicht gefunden worden, andererseits waren die Morrisseys wirklich sehr wütend gewesen, als sie herausfanden, dass ich tot war.
Seamus hatte verbreiten lassen, Franc und Alcais hätten mich getötet und damit ganze Arbeit geleistet. In schlaflosen Nächten fragte ich mich, ob Alcais’ Tage wohl gezählt waren. Ich schätzte, das hing vom Einflussbereich der Morrisseys ab, und davon, wie gut sie etwas im Gedächtnis behielten.
Wie versprochen, hatte Seamus Erins Überführung zu ihrer Mutter organisiert. Dorthea war langegenug geblieben, um die sterblichen Überreste ihrer Tochter zu empfangen, doch noch am selben Tag war die Heilergemeinde samt ihrem Hab und Gut spurlos verschwunden. Leer stehende Häuser und ausgestöpselte Telefone waren der einzige Beweis dafür, dass sie in Pacifica gelebt hatten. Manche von uns spekulierten, dass sie sich in alle Winde verstreut und den Gedanken an eine Gemeinde vollkommen aufgegeben hätten. Ich hoffte, sie hätten sich entschieden, anderswo einen Neuanfang zu wagen. Franc hatte sie betrogen, aber das hieß nicht, dass alles, was er getan hatte, falsch gewesen
Weitere Kostenlose Bücher