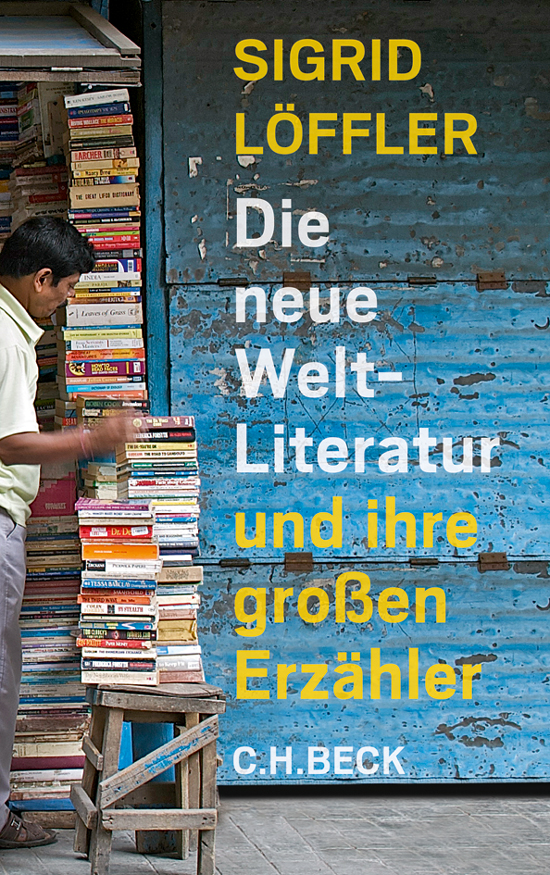![Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler]()
Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler
schwer lastenden Gestank toter Körper erfüllt. Wir folgten einer Flussbiegung und sahen Vogelkadaver vor uns, auf Ãste drapiert, die schlaffen Flügel schwarz und glitschig vom Ãl; tote Fische schaukelten mit den weiÃen Bäuchen nach oben zwischen den Baumwurzeln.»
«Ãl auf Wasser» erzählt, elegisch und schwermütig, eine Geschichte von Gewalt und Hoffnungslosigkeit in einem ausgebeuteten und ruinierten Land, in dem die Globalisierung eben jene Ressourcen zerstört, auf die sie angewiesen ist. Gerade in seinem zurückhaltenden Erzählduktus, der es vermeidet, sich auf die Seite irgendeiner der Konfliktparteien zu schlagen, ist der Roman eine beklemmende und erschreckend aktuelle Lektüre.
Wenn Autoren afrikanischer Herkunft über die Ankunftsproblematik von Afrikanern in den USA erzählen, so geht es dabei immer auch um Phantomschmerzen. Was nicht mehr vorhanden ist, tut weh. Und was schmerzt, ist die verlorene Heimat. Die Erinnerung an das Herkunftsland rumort in den Köpfen und Herzen der Romanhelden so mancher Autoren, selbst dann, wenn sie vor Bürgerkriegen und Gewaltregimes, vor Elend und Drangsal geflüchtet sind. Wie beispielsweise Kenneth, Joseph und Stephanos, die drei Einwandererhelden in dem Roman «Zum Wiedersehen der Sterne» von dem gebürtigen Ãthiopier Dinaw Mengestu, auch er einer der «Twenty Under Forty» auf der Liste des «New Yorker».
Jeden Dienstag nach der Arbeit treffen sie sich: Kenneth, Joseph und Stephanos. Sie sitzen um den Klapptisch im Hinterzimmer von Stephanosâ Laden am heruntergekommenen Logan Circle in Washington D. C., trinken Scotch aus Styroporbechern, ziehen einander mit ihrer Herkunft und ihrem Aussehen auf, was ein bisschen rassistisch klingt, aber als nette Frotzelei gemeint ist, und spielen Staatsstreich. Sie sind miteinander befreundet, seit sie vor siebzehn Jahren neu ins Land kamen â Kenneth aus Kenia, Joseph aus Zaire und Stephanos aus Ãthiopien. Sie lernten einander kennen, als sie alle drei als Pagen und Kofferträger im Capitol Hotel arbeiteten. Heute ist Kenneth Ingenieur, Joseph ist Kellner, und Stephanos führt einen kleinen Gemischtwarenladen.
Auch siebzehn Jahre nach ihrer Ankunft in den USA haben sie nur einander als Freunde. Der Kulturwechsel ist ihnen nicht so recht geglückt, in Amerika haben sie nicht wirklich Fuà gefasst, immer noch sind sie über die afrikanische Diaspora nicht hinausgelangt. Immer noch driften sie ohne festen Halt zwischen Herkunft und Ankunft,hängen zwischen zwei Kulturen in der Luft und sehnen sich insgeheim nach Afrika zurück â was sie mithilfe des Staatsstreich-Spiels auch vor sich selbst zu verbergen suchen. Sich die postkolonialen Fehlentwicklungen ihres Heimatkontinents vor Augen zu halten, ist als Anti-Nostalgicum gedacht, funktioniert aber nicht so recht.
Im Hinterzimmer hängt gleich neben der Tür eine groÃe, aber bereits veraltete Afrika-Karte, denn weder Grenzen noch Ländernamen stimmen noch. «Ich bin aus Zaire», sagt Joseph, nur um sich sofort zu korrigieren: «Vielleicht komme ich morgen schon aus Laurent Kabilas Befreitem Land. Aber heute bin ich, soweit ich weiÃ, aus der Demokratischen Republik Kongo. Ich gebe zu, nächste Woche könnte sie schon anders heiÃen.»
Und so funktioniert das Spiel: Einer nennt einen afrikanischen Diktator, die anderen müssen das Land erraten und das Jahr, in dem der Genannte geputscht hat. Ãber dreiÃig afrikanische Staatsstreiche haben sie bis jetzt beisammen, und ein Ende ist nicht abzusehen. Jeder von ihnen hat seine Lieblinge unter den Putschisten. «Bokassa. Amin. Mobutu. Wir lieben alle, die berühmt sind für absurde Proklamationen und skurrile Auftritte, Diktatoren, die vierzig Frauen und doppelt so viele Kinder haben, auf goldenen Thronen in Gestalt eines Adlers sitzen, sich zu Göttern ernennen und um die sich Gerüchte über Inzest, Kannibalismus und schwarze Magie ranken.»
Dinaw Mengestu hat im Jahr 2007 mit dem Roman «Zum Wiedersehen der Sterne» in den USA debütiert. Er ist Amerikaner äthiopischer Herkunft und wurde 1978 in Addis Abeba geboren. Im Alter von zwei Jahren kam er mit seiner Mutter und seiner Schwester in die USA. Sein Vater, der dem alten Prinzen-Regime in Ãthiopien nahestand, war aus politischen Gründen bereits 1977 vor dem «Roten Terror» des Militärdiktators Mengistu Haile
Weitere Kostenlose Bücher