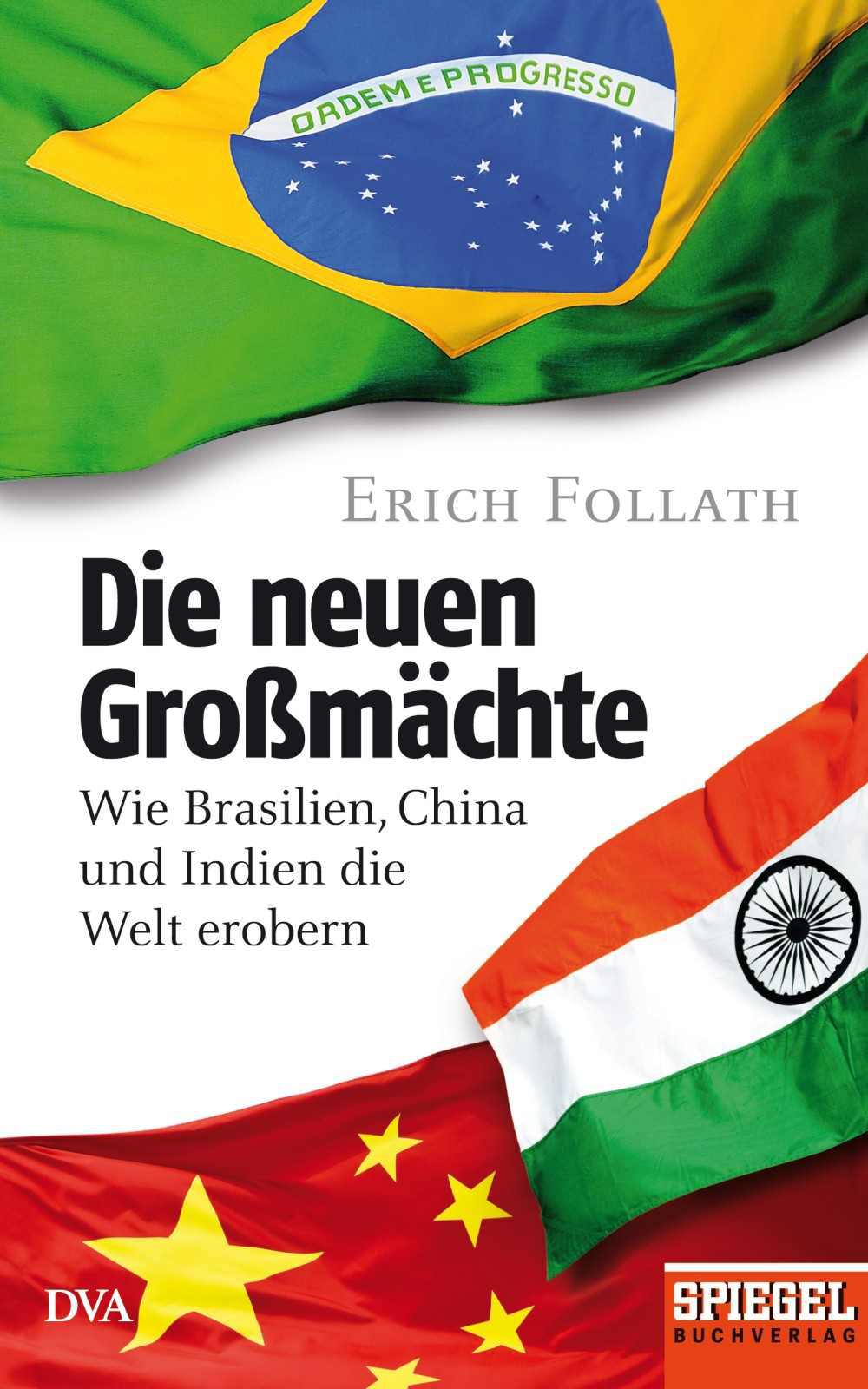![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
Gros der Unterstützer; Beamte und Bankangestellte, Krankenhausärzte und Computeringenieure, Boutiquenbesitzer und Prokuristen. Und erstaunlich viele junge Leute sind unter den Hazare-Sympathisanten, Studenten und Schüler. Ein bisschen erinnert das, was da im Sommer 2011 passiert, an die Ereignisse auf dem Tiananmen-Platz in der chinesischen Hauptstadt 1989. Doch die Gewalt, für die sich Chinas Machthaber damals entschieden haben, kann für Indiens Machthaber keine Option sein – so zeigt die Demokratie selbst in den Tagen der Schwäche ihre Überlegenheit.
Nach zwölf Tagen des Hungerstreiks beugen sich die Regierenden den Forderungen des Bürgerrechtlers und versprechen die zügige Verabschiedung eines umfassenden Antikorruptionsgesetzes, einschließlich eines unabhängigen Ombudsmann-Gremiums. Hazare nimmt ein bisschen Honig und Kokosmilch zu sich, verabschiedet sich von der Hauptstadttribüne im Triumphzug und kehrt in sein Dorf zurück. Im Dezember 2011 beschloss zunächst das Unterhaus die entsprechenden Gesetzmaßnahmen, das Oberhaus schob sie dann wieder auf die lange Bank. Wie immer man diesen (Teil-)Erfolg des Aktivisten bewerten mag, es bleiben doch entscheidende Fragen: Ist seine Volksbewegung wirklich die Geburtsstunde einer neuen, machtvolleren Zivilgesellschaft, wie seine Anhänger frohlockten? Oder beschädigt sie im Gegenteil die demokratischen Institutionen, trat »der große Fluss der Bewegung über die Ufer der Verfassung und zeigte Schattenseiten der Anarchie«, wie das indische Nachrichtenmagazin Outlook warnte? Ein Besuch bei Hazare zu Haus soll Aufschluss darüber geben.
Fünf Stunden sind es von Bombay, der Weg führt auf den letzten hundert Kilometern durch eine verdorrte Landschaft. Holprige Wege mit Kamelen am Straßenrand, vorbei an schmutzstarrenden Teestuben, machen den Wutausbruch des Bundesministers für ländliche Entwicklung verständlich. »Wir sind das dreckigste Land der Erde«, brach es kürzlich aus Jairam Ramesh heraus, einem der wenigen Politiker in Indien, die Klartext reden. Aber sobald der Wagen nach Ralegan Siddhi einbiegt, sieht alles ganz anders aus. Da fallen die sauber gefegten Straße, die propere Schule mit dem angeschlossenen Computerzimmer, das Bewässerungsprojekt, das für die reichlich Früchte tragenden Felder sorgt, sofort ins Auge. All das unterscheidet dieses Dorf von den anderen in der Gegend.
Der Sozialaktivist Hazare, inoffizieller Bürgermeister, ist stolz darauf, was er hier erreicht hat. Er besteht darauf, vor der Beantwortung von nationalen Fragen durch sein 3000 Einwohner zählendes Dorf zu führen. »Mein Geburtsort Ralegan Siddhi soll ein Modell sein, ich will, dass es hundertfach in Indien kopiert wird«, sagt er mit dem Selbstbewusstsein eines erfolgreichen Kriegers. Er trägt ein blütenweißes Gandhi-Schiffchen auf dem Kopf, den typischen Baumwollschurz des Mahatma. Auf dem Dorfplatz steht eine riesige Gandhi-Büste, daneben, in einem bescheidenen Ashram, bewohnt Hazare, Junggeselle wie sein Idol, ein mit Büchern vollgestopftes Zimmer.
Mit zwölf brach er die Schule ab, verkaufte für den Rest seiner Jugend auf den Straßen von Bombay Blumengirlanden, lebte ohne feste Unterkunft. Trat 1963 als glühender Patriot in die Armee ein. Während des Krieges gegen Pakistan 1965 war er dann an seinem Grenzposten der einzige Überlebende eines feindlichen Luftschlags. Dankbar und überzeugt von einem göttlichen Auftrag, beschloss er, auf eine Militärkarriere zu verzichten und sein Land umzukrempeln. »Ralegan Siddhi lag am Boden. Die meisten Männer lebten vom illegalen Schnapsbrennen und waren selbst Alkoholiker geworden«, erzählt Hazare. »Mit Überzeugungsarbeit und, wenn es sein musste, auch mit Härte habe ich den Wandel im Dorf herbeigeführt.« Pause. »Wen ich nach dreimaliger Warnung immer noch mit Alkohol erwischte, der wurde an einen Pfosten gebunden und ausgepeitscht.« Bis heute sind im Dorf Alkohol und Zigaretten verboten, wer es wagte, würde von Hazare geächtet. Auch bei seinen sozialen Kämpfen blieb Hazare seinem fanatischen Willen zur Verbesserung der Nation und der Lebensverhältnisse treu.
Schon 1991 hatte Hazare in der Vetternwirtschaft das Grundübel der indischen Gesellschaft erkannt. »Unsere Eliten haben das Land gründlicher ausgeplündert als die Kolonialherren«, sagt er. Der »Große Bruder« gründete eine »Volksbewegung gegen Korruption«, die damals allerdings nur regional wahrgenommen wurde. »Jetzt aber
Weitere Kostenlose Bücher