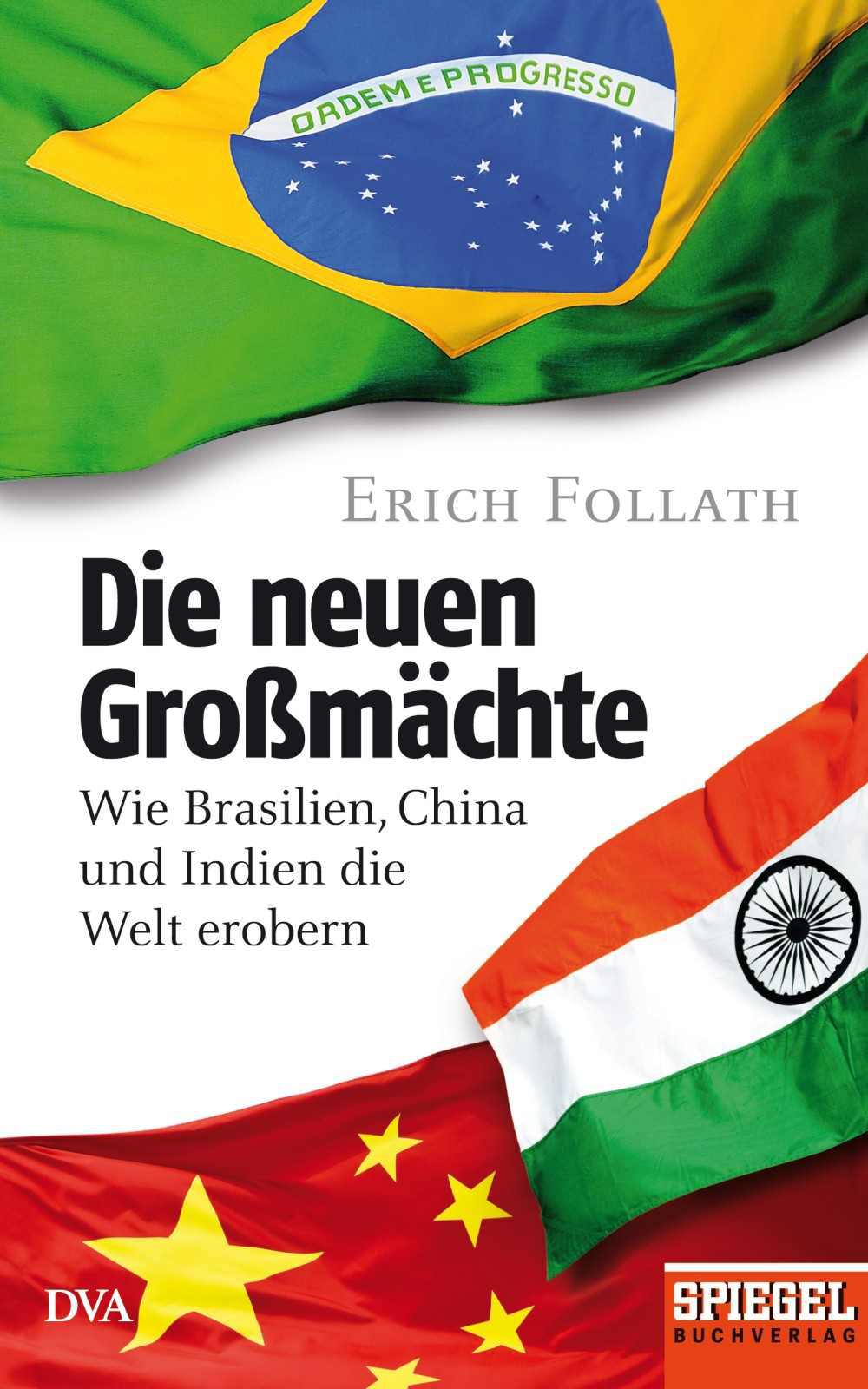![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
zurück, auf die Fähigkeit, sich kreativ durchzuwursteln. Ob das freilich reicht, gegen die Konkurrenz auf Dauer zu bestehen und im weltweiten Kampf der Mächte entscheidend aufzuholen, da sind sich die Elitestudenten nicht sicher. Etwa die Hälfte ist sehr optimistisch, die andere gibt sich eher skeptisch. Und in dieser zweiten Gruppe sind auch die meisten der Auswanderungswilligen zu finden. Als Ziele nennen wenige den Westen, sie sehen ihre Zukunft eher in Dubai, Schanghai und São Paulo.
Die künftigen Business-Profis zeigen sich bei den Spontaninterviews in der Cafeteria schlagfertig, witzig, weltgewandt. Nur auf die Frage, wofür »Red Sorghum« (»rote Hirse«) steht, weiß keiner eine Antwort. Und »Protex«? Wieder allgemeines Kopfschütteln. Es sind Begriffe aus einer anderen Welt, mit der die ISB -Absolventen wohl nie konfrontiert werden dürften. Sie werden bald zur Spitze der Gesellschaft oder doch mindestens zur oberen Mittelklasse gehören, zu den Kreisen, die sich im indischen Alltag vollkommen von dem Rest des Landes abschotten. Sie werden Fahrer haben und Autos mit Klimaanlage, Torwächter in den Häusern ihrer überwachten Wohngebiete. Sie werden dort ihren Tee mit Mineralwasser aufkochen, um der verseuchten Brühe aus dem Wasserhahn zu entgehen, und über eigene Generatoren verfügen, die im Fall eines Stromausfalls sofort anspringen. »Hier beneiden die Götter die Menschen«, wirbt eine dieser Gated Communities in großen Lettern an Hyderabads Stadtautobahn.
Für Menschen, die hundert Kilometer nördlich und östlich von Hyderabad arbeiten, Bürger desselben Bundesstaates Andhra Pradesh, sind »Red Sorghum« und »Protex« Begriffe aus ihrem täglichen Existenzkampf. Sie leben im anderen Indien. Sie schuften als weitgehend rechtlose Wanderarbeiter in chemischen Fabriken und in Stahlwerken, meist ohne Schutzkleidung. Nicht einmal China hat eine so horrende Zahl an Unfällen, auf Baustellen traf es zuletzt 165 von 1000 Arbeitern. Oder sie beackern die kargen Böden und wissen oft nicht, ob sie ihren Frauen und Kindern in den nächsten Wochen noch etwas Essbares auf den Tisch stellen können. Jede Fahrt über das weite indische Land ist eine Zeitreise – zurück in eine Epoche von Schuldknechtschaft und Manchester-Kapitalismus.
Zum Beispiel Nizambad, zweieinhalb Autostunden von Hyderabad entfernt. Da haben die Bauern wie in so vielen Landesteilen mit Saatgut experimentiert, das ihnen von internationalen Konzernen anfangs zu Billigstpreisen überlassen worden war. »Rote Hirse« und das gleichzeitig als Pestizid ausgebrachte »Protex« galten wegen der anfangs guten Erträge als Zaubermittel. Heute betrachten die Dorfbewohner sie als Fluch. Die Böden sind nach drei bis vier Ernten ausgelaugt und brauchen immer mehr Düngemittel. Den höheren Ertrag haben die Zwischenhändler abgeschöpft, die künstlich die Hirse-Preise drückten und so die Bauern zu immer höheren Schulden zwangen. Tausende Bauern nahmen sich in Indien in ihrer Verzweiflung schon das Leben, mehrere hundert auch hier in Andhra Pradesh. Für viele war es ein besonders qualvoller Tod: Sie tranken das hochgiftige Mittel, von dem sie sich ihren wirtschaftlichen Aufstieg erhofft hatten.
Eine Reise aufs Land rückt auch andere Größenordnungen zurecht: Mehr als 400 Millionen Inder, die Hälfte der Erwerbstätigen, arbeiten auf den Feldern und erwirtschaften nicht einmal 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; weniger als drei Millionen Inder arbeiten in der Informationstechnologie und erwirtschaften gut 6 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. »Wir versuchen unsere Kinder in die Stadt zu schicken, jeder Job ist besser als das hier«, sagt in Nizambad, Ortsteil Hasakothur, Bauer Kiran und bittet in seine kleine Hütte zu einer Tasse Tee – eine Geste, die kein Gast abschlagen darf, auch wenn er das Opfer ahnt, das ihm gebracht ist, und ihm auch selbst gar nicht daran gelegen ist, beim kostbaren Zucker zuzulangen. Es ist eine sehr bescheidene Bleibe. Der Dung, den der Familienvater sammelt, hat zahlreiche Fliegen angelockt, die sich auf die Gesichter der schlafenden Kinder setzen. Unter dem Holzbett hängt, einziger Schmuck im Raum, ein Kalenderblatt mit dem Abbild Lakshmis, der hinduistischen Göttin des Glücks.
Kiran glaubt, er sei so um die sechzig, genau weiß er sein Alter nicht. Er wirkt mit seinem fast zahnlosen Gebiss, den grauen Haaren und seinem ausgemergelten Körper wie ein Greis. Wie alle im Dorf steht er bei
Weitere Kostenlose Bücher