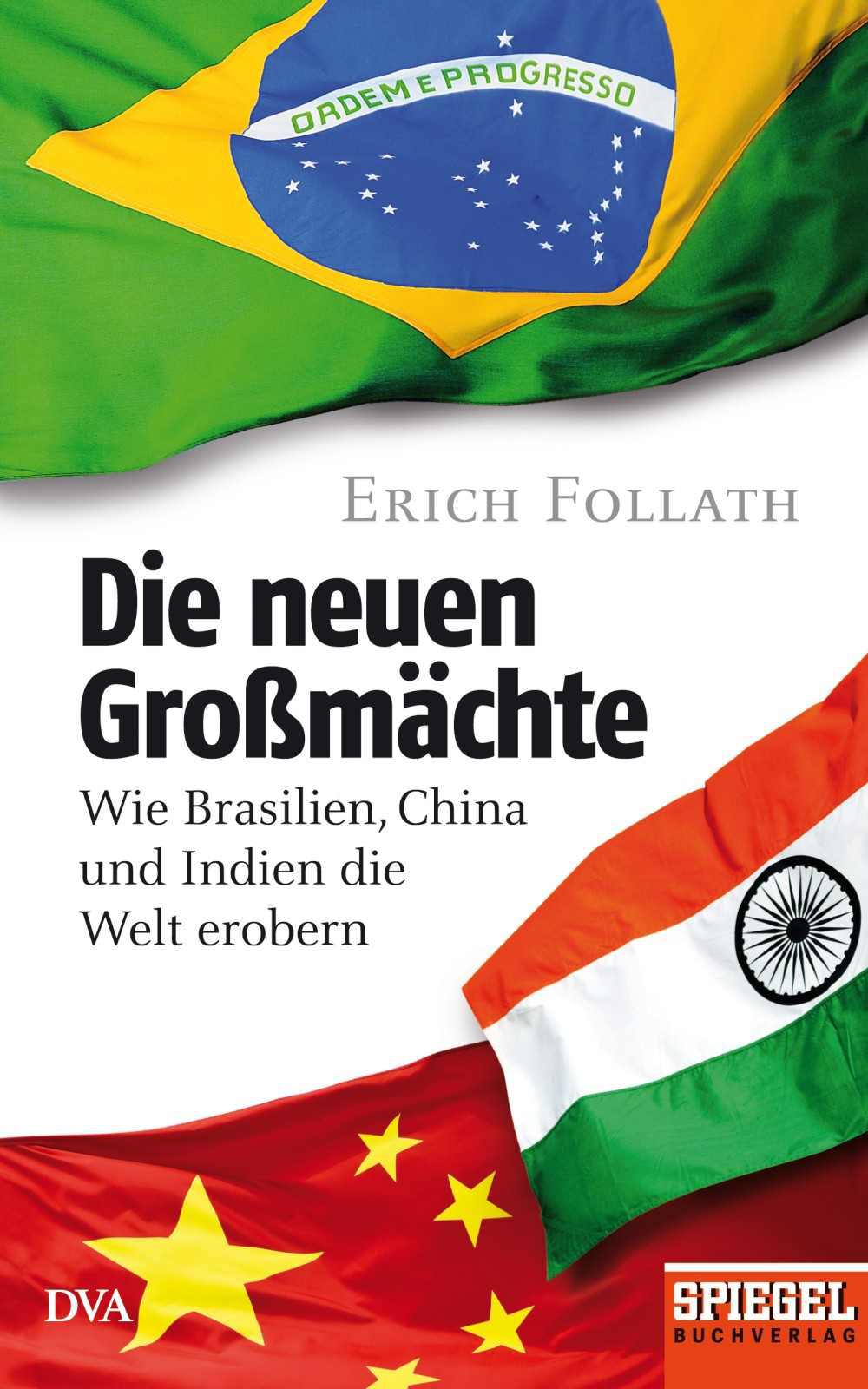![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
Golkonda-Festung, das Charminar-Denkmal mit seinen vier Minaretten in der Altstadt. Aber fragt man einen Taxifahrer nach dem Zentrum, wird er nicht zum Gewirr der quirligen Straßen fahren, die sich wie Spinnweben um den Charminar-Platz ausbreiten, sondern unweigerlich in das neue Viertel. Zu den Shopping Malls, den IT-Firmensitzen, den Bio- und Gen-Laboratorien und Hochschulen. Hyderabad, die Sieben-Millionen-Metropole im Zentrum des Landes, heißt im Volksmund längst »Cyberabad« – es ist neben Bangalore die Hightech-Kapitale des Landes. Hier befindet sich auch die Universität, die in Umfragen regelmäßig zur Nummer eins der auf Wirtschaft spezialisierten indischen Institute gewählt wird. Das Institut, das nach einer von der Financial Times erstellten Rangfolge weltweit zur Top Twenty gehört: die Indian School of Business (ISB), das neue Juwel von Hyderabad, sozusagen.
Der Campus mit seinen luftigen rosaroten Gebäuden, eingebettet in eine sorgfältig gepflegte Parklandschaft und durch Tore von der Außenwelt abgeschirmt, wirkt wie eine Insel im sonstigen Gewimmel der Stadt. »Diese heitere Gelassenheit ist beabsichtigt, wir sehen uns gern als ein Tempel des Lernens«, sagt Dekan Ajit Rangnekar, der vorher über ein Jahrzehnt lang in Hongkong gearbeitet hat. »Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Hier wird extrem hart gearbeitet. 16-Stunden-Tage sind für unsere Studenten normal.« Dass hier nur die absolute Elite zum Zug kommt, stellen die schwierigen Aufnahmeprüfungen und auch die Gebühren sicher: 40000 US -Dollar kostet das Jahr an der ISB. Und eine Chance hat ohnehin nur, wer ein abgeschlossenes anderes Studium vorweisen kann und auch schon Berufserfahrung gesammelt hat. Alle Studenten müssen auf dem Campus leben, es gibt Sportprogramme zur Entspannung auf dem Gelände, auch mal eine Weinprobe. Ablenkung allerdings ist unter den Supermotivierten kaum gefragt. Hier zählen nur die Lehrer, das Programm, der Konkurrenzkampf mit den Kommilitonen. Die rund 800 Studenten der ISB sind eine Zweckgemeinschaft auf Zeit, eingeschworen auf den Erfolg, zusammengeschweißt in einer Kaderschmiede. Verglichen mit Oxford oder Harvard steckt diese Uni noch in den Kinderschuhen. Ins Leben gerufen wurde sie 1996 von indischen Wirtschaftsfachleuten der internationalen Consulting-Firma McKinsey »in Kooperation mit dem indischen Staat«, wie es in der ISB -Broschüre heißt. Die ersten Studenten kamen 2001. Bis heute wird das Institut weitgehend mit Geldern von Privatunternehmern finanziert und konnte seinen Ruf als Top-Universität ausbauen; einer der Gründerväter musste sich inzwischen wegen dubioser Geschäfte verabschieden. Man achtet hier sehr auf Skandalferne.
Die Studenten haben schon jetzt enge Kontakte zu den besten Firmen des Landes, deren Chefs kommen als Vortragende und Werbende. Die ISB -Zöglinge besitzen das größtmögliche Spektrum an Chancen. Was aber wollen die Auserwählten? Glauben sie an Indien und seine Weltmacht-Chancen, inwieweit fühlen sie sich noch den zwei Dritteln ihrer Landsleute verbunden, die als Bauern oder Wanderarbeiter täglich um ihre Existenz kämpfen müssen?
Für die Leistungen und Fähigkeiten der Regierenden in Neu-Delhi haben sie nur Verachtung und Zynismus übrig. Korruption und Vetternwirtschaft sind in ihren Augen »endemisch«. Parteien und ihre Vertreter sehen die jungen Leute nur als geschäftehemmendes Hindernis. »Wenn in Indien etwas klappt, dann nicht wegen der Politik, sondern trotz der Politik«, sagt Kumar. Aber auf die Stimmabgabe ganz verzichten, ist für ihn keine Option. Wie alle der Befragten geht auch er regelmäßig zur Wahl. Die meisten Studenten wollen bei großen Firmen anfangen, einige sich als Unternehmer versuchen. Die IT -Branche lockt. »Wir haben Vorteile durch unseren Pool gut ausgebildeter, innovativer Fachkräfte und außerdem durch die Demografie – unsere Gesellschaft altert nicht so schnell wie die in China und im Westen«, meint Student Sunil. Und die Inder hätten noch einige Pluspunkte mehr: Europäische und chinesische Studenten gehen seiner Meinung nach zwar methodischer an Problemstellungen heran, seien aber bei unerwarteten Wendungen im Nachteil. »Wir sind gewohnt zu improvisieren, wir müssen das im Alltag lernen. Bei uns kommt von Stromausfällen bis zu wilden Streiks immer etwas dazwischen«, ergänzt Kommilitone Rajnee. Tatsächlich führen nach einer Studie 81 Prozent aller indischen Geschäftsleute ihren Erfolg auf jugaar
Weitere Kostenlose Bücher