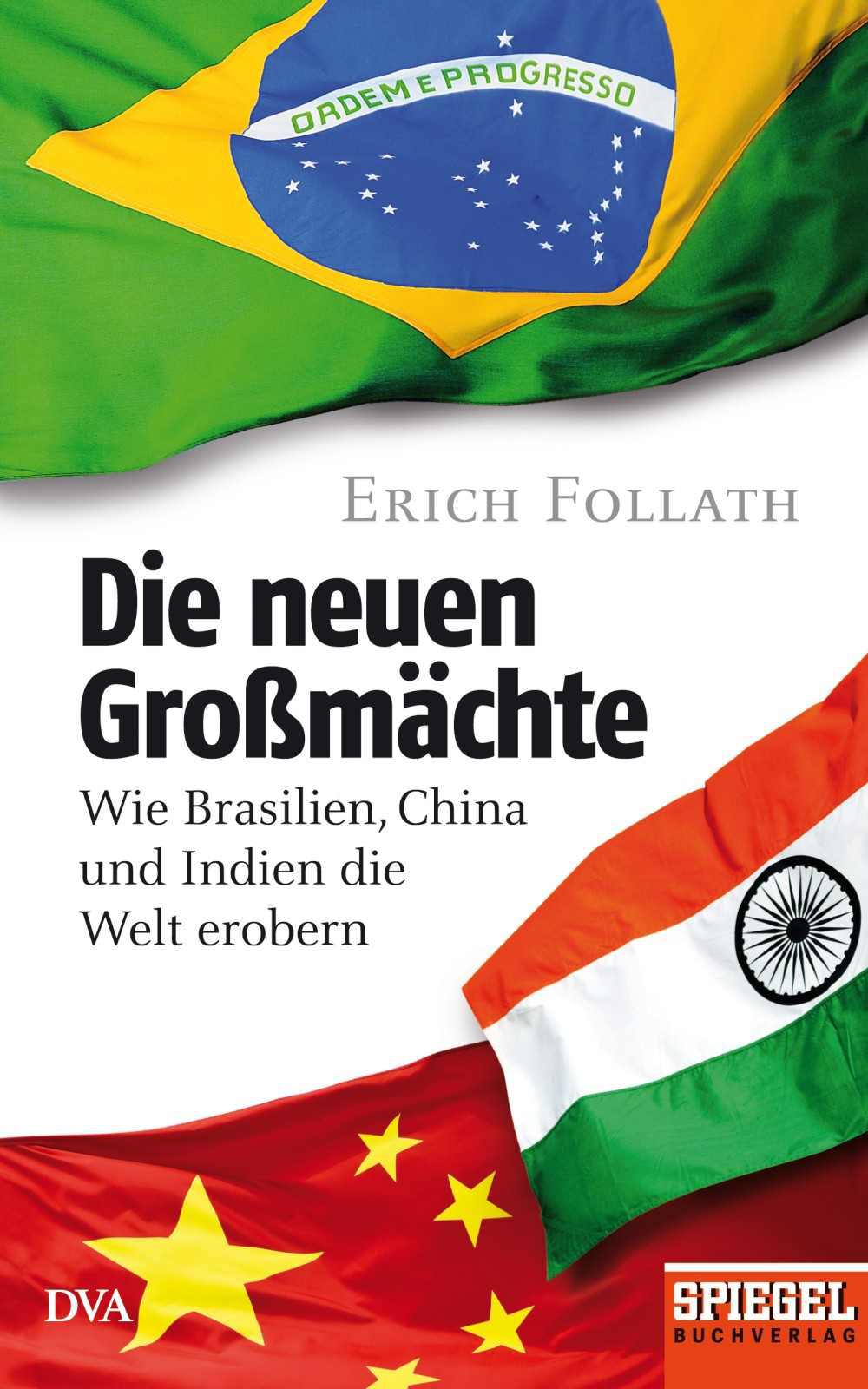![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
Arbeit für eines seiner Mitglieder garantiert. 100 Tage im Jahr, pro Tag 130 Rupien; das ist nicht viel – etwa zwei Euro –, aber für die meisten schon ein Fortschritt. Und so sieht man täglich zwischen Kerala und Kaschmir Millionen von Teilzeitstaatsarbeitern an Straßen und Brunnen arbeiten. Im vergangenen Jahr sollen 50 Millionen – jeder vierte ländliche Haushalt in Indien – an dem Programm teilgenommen haben. Was aber ist mit den anderen drei Vierteln? Und ist das MGNREGA mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, funktioniert die Bezahlung?
Sehr unterschiedlich war die Beurteilung, als Medien bei den Bauern Stichproben machten. In manchen Regionen half die Initiative den Ärmsten. Es klappte auch einigermaßen mit der versprochenen Entlohnung, die absolute Armut und der Zwang zur Kinderarbeit wurden etwas gelindert. In anderen Regionen erzählten die Betroffenen empört, sie verbrächten genauso viel Zeit mit dem Eintreiben der Gelder, wie sie arbeiten, die Bürokraten vor Ort hielten den Lohn einfach zurück, zahlten ihn auf eigene Konten ein. Und dann gibt es Bundesstaaten, in denen noch keiner so richtig von MGNREGA gehört hatte und in denen die entsprechenden Beamten aus Neu-Delhi sich nicht als Arbeitsplatzbeschaffer, sondern als Verhinderer begriffen. Eine wirksame Kontrolle scheint jedenfalls nicht stattzufinden. Und so versickert die MGNREGA -Initiative vielfach im Sand, ähnlich wie bei anderen theoretisch Erfolg versprechenden Sozialprojekten.
Auf dem Papier und in der Theorie ist in Indien vieles großartig und gut durchdacht, in der Praxis aber scheitert es an Korruption und bürokratischen Hemmnissen, an Nepotismus und fehlendem Gemeinsinn. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den teilweise hocheffizienten, innovativen und brillant geführten privaten Unternehmen und der lethargischen, uneffizienten öffentlichen Hand. Und dabei ist die grundsätzliche Frage, ob die indischen Sozialprogramme denjenigen, die von ihnen profitieren sollen, wirklich nachhaltige Werkzeuge zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in die Hand geben, noch gar nicht gestellt. Die staatlichen Gelder für Schulbildung und Gesundheitsfürsorge sind nur in bescheidenem Ausmaß gestiegen, wenn auch die Analphabetenrate innerhalb eines Jahrzehnts von 48 Prozent auf etwa 30 Prozent gefallen ist – allerdings können immer noch wesentlich weniger Mädchen als Jungs schreiben und lesen, ein Beweis ihrer Vernachlässigung. Viele der schlecht bezahlten Lehrer kommen nur ein-, zweimal in der Woche zu ihrem Job, sie müssen oftmals anderweitig arbeiten.
Die Eltern sind oft weiter als die Regierung – sie haben begriffen, dass Fortschritt an einer besseren Ausbildung hängt. Wer immer es sich leisten kann, schickt sein Kind in eine der privaten Schulen oder bezahlt die staatlichen Lehrer wenigstens für private Nachhilfe. Jobs wären da: Eine neue staatliche Studie zeigt, dass es Indien schon heute an Fachkräften mangelt. Das Land verfügt demnach über etwa 500000 ausgebildete Ingenieure, bräuchte aber vier Millionen.
Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 sorgte immerhin dafür, dass die internationalen Ratingagenturen davon Abstand nahmen, die Kreditwürdigkeit des Landes wie gedroht weiter herabzustufen. Große Reformschritte würden ein Umdenken bedeuten: Einen wirklichen Kampf gegen die Korruption durch die politischen Eliten, neue gesellschaftliche Weichenstellungen im Umgang mit Frauen, eine Generalüberholung der investitionshemmenden Bürokratie, mehr Transparenz. In dem »Doing Business«-Bericht der Weltbank, der das Geschäftsklima in 180 Staaten beurteilt, liegt Indien auf Rang 134 – weit hinter den vergleichbaren Konkurrenten China und Brasilien. Als eine freie oder gar soziale Marktwirtschaft lässt sich das Land kaum bezeichnen, dazu sind die Aufstiegschancen zu ungleich verteilt. Und einzelne Industriezweige bleiben de facto Staatsmonopol, wie etwa die für den Elektrizitätsengpass wesentlich verantwortliche Kohleförderung. 60 Prozent des Stroms in Indien werden durch Wärmekraftwerke generiert. Sie sind so schlecht geführt, dass sie es nicht schaffen, genug zu fördern, obwohl Indien über eines der größten Kohlevorkommen weltweit verfügt. Die Energiebeschaffung bleibt ohnehin die große Achillesferse des Landes. Selbst wenn es gelingen sollte, gegen den Widerstand breiter Bevölkerungsschichten mehr Atomkraftwerke zu bauen, wird der Zwang zu mehr Importen stark steigen. Nach
Weitere Kostenlose Bücher