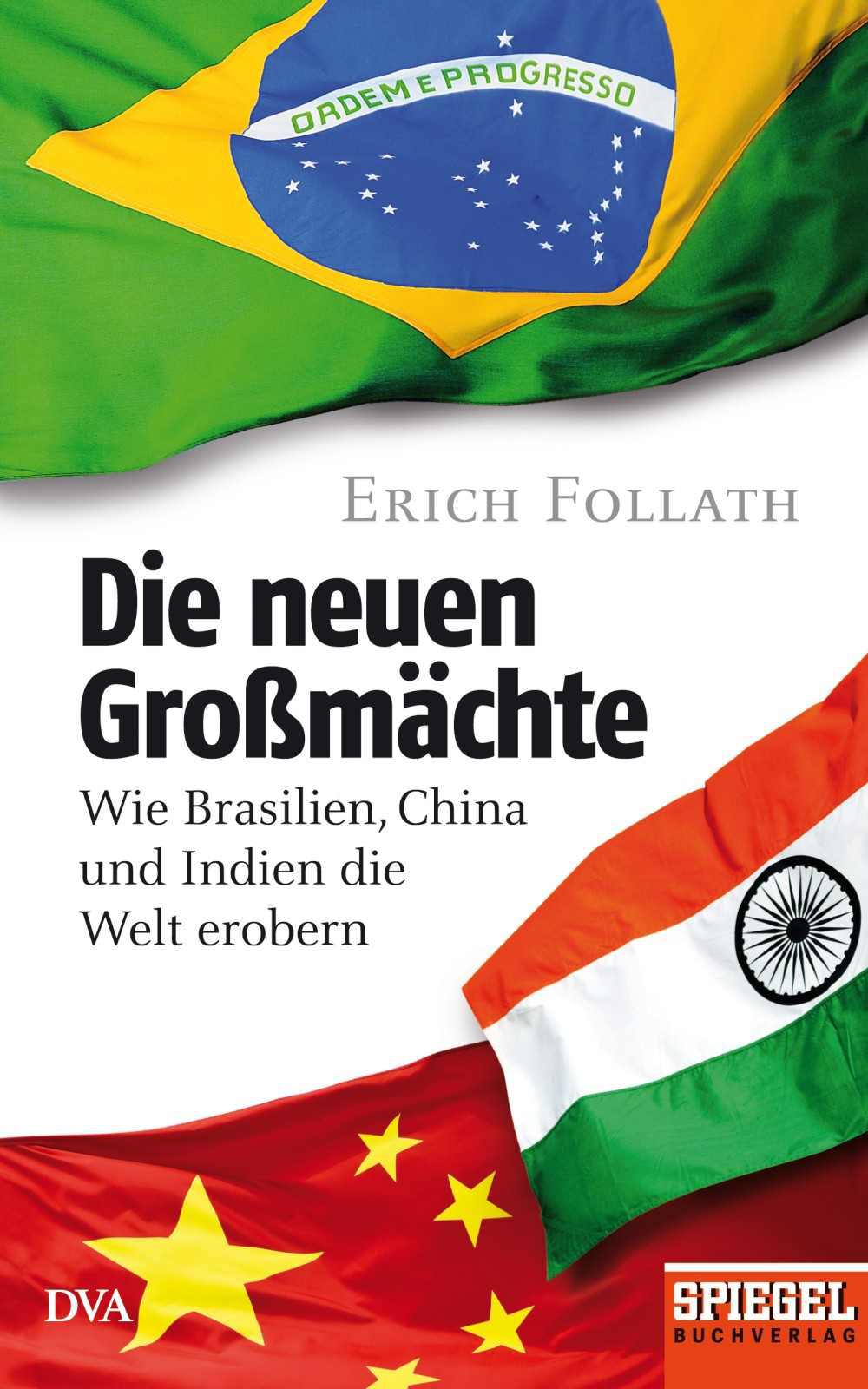![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
wenig Bettler oder unterprivilegierte Favela-Bewohner. Was Brasilien da am Rand des Confed Cup erlebte, war ein Aufstand im (relativen) Wohlstand. Er richtete sich eher gegen die Prioritäten der politischen Elite allgemein als direkt gegen die Staatspräsidentin. Aber die sonst von Umfragewerten so verwöhnte Rousseff musste schon erleben, wie ihre Spitzenwerte rapide fielen, auf nur noch 40 Prozent Zustimmung.
Das Aufbegehren auf den Straßen traf die Präsidentin und ihr Team offensichtlich völlig unvorbereitet. Beim Eröffnungsspiel zur WM -Generalprobe wurde sie von den Fans ausgepfiffen. Zum Finale, das die Seleçao so glanzvoll gegen Spanien gewann, getraute sie sich gar nicht mehr ins Stadion und sagte auch eine Reise nach Japan ab. Der Protest rückte sehr nahe an ihren Amtssitz heran. In der Hauptstadt stürmten die Demonstranten das Gebäude des Nationalkongresses und drangen auf das Dach des Senats vor, das sie stundenlang besetzt hielten.
Die Präsidentin trat nach quälend langen Tagen des Schweigens die Flucht nach vorn an und wandte sich in einer Ansprache ans Volk: »Die friedlichen Proteste sind legitim, diese Stimmen müssen gehört werden«, sagte sie. Rousseff ließ die Fahrpreiserhöhungen zurücknehmen, sagte tiefgreifende Reformen für das Bildungssystem, das Gesundheitswesen und den öffentlichen Nahverkehr zu. Die Verwaltung müsse und werde »wesentlich effizienter« als bisher arbeiten. Außerdem versprach sie eine – in der Verfassung Brasiliens freilich gar nicht vorgesehene – Volksabstimmung. Zumindest vorübergehend gelang es ihr so, die Situation zu beruhigen. Als einen Monat nach Ende des Confed Cup die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufriefen, folgten nur wenige Tausende. Die junge Elite, eher spontan unterwegs und über soziale Netzwerke verbunden, schien auf Abwarten zu setzen. Aber die meisten fanden Rousseffs Reaktion zu zögerlich, zu wenig durchdacht. Sie sehnten sich nach dem Charismatiker Lula und dessen Fähigkeit zu wirklich innovativer Politik und einem echten Dialog mit dem Volk zurück.
Das Geld für die teuren Sozialleistungen sei da, auch die zu erwartenden Einnahmen aus versteigerten neuen Erdölfeldern würden zur Finanzierung herangezogen, sagte die Präsidentin. Nicht alle teilten ihren Optimismus. 2010 war zwar noch ein sehr gutes Wirtschaftsjahr, ganz in der Tradition des vorangegangenen lang anhaltenden Aufschwungs. Plus 7,5 Prozent. 2011 war dann für die Ansprüche der lateinamerikanischen Führungsnation schon eher bescheiden, plus 3 Prozent. Und 2012 war das Wirtschaftswachstum für ein aufstrebendes Schwellenland mit Großmachtambitionen dann schon sehr mager – nur mehr plus 0,9 Prozent. War nur eine Delle, sagen die Optimisten unter den Ökonomen, es geht ja schon wieder aufwärts, und verweisen auf den für das Jahr 2013 prophezeiten 2,5-Prozent-Aufschwung. Vorsicht, sagen die Pessimisten der Branche: So lange die Investitionen der brasilianischen Konzerne im Land nicht wieder anspringen, bleibt die Lage prekär. Und die stagnieren, vor allem in so wichtigen Bereichen wie der Energieversorgung und der Beseitigung der Infrastrukturmängel. Die Kapitalrendite sei zu niedrig, die Reglementierungswut zu ausgeprägt, klagen die einheimischen Unternehmen. Es lohne sich einfach nicht, Geld in Raffinerien und Thermokraftwerke zu stecken. Anders sehen das ausländische Firmen. Vor allem Konzerne aus Europa investieren riesige Summen in neue Fabriken und Firmenübernahmen. Im Jahr 2012 flossen so 60 Milliarden US -Dollar nach Brasilien, mehr als in jeden anderen Staat außer die USA und China. Doch es kamen vor allem Unternehmen, die Konsumartikel herstellen oder verkaufen wollen, von Kosmetika bis Handys und Autos.
ThyssenKrupp beispielsweise leistete sich mit seiner 5,2 Milliarden teuren Stahlhütte in Brasilien einen Megaflop. Das Essener Werk machte so ziemlich alles falsch, was man falsch machen konnte, setzte beim Bau auf günstiges Material aus China, das sich als Schrott erwies und komplett ersetzt werden musste. Aber die meisten deutschen Firmen stürzten sich nicht so leichtsinnig ins brasilianische Abenteuer. Bayer und die Deutsche Bank machen im größten Land Südamerikas schon seit über hundert Jahren gute Geschäfte; auch Siemens, allerdings musste die Münchner Firma wegen korrupter Praktiken im Sommer 2013 zur Selbstanzeige greifen. BMW will ab 2014 in einem neuen Werk im Süden des Landes Autos bauen, 30000 pro Jahr. Mehr als
Weitere Kostenlose Bücher