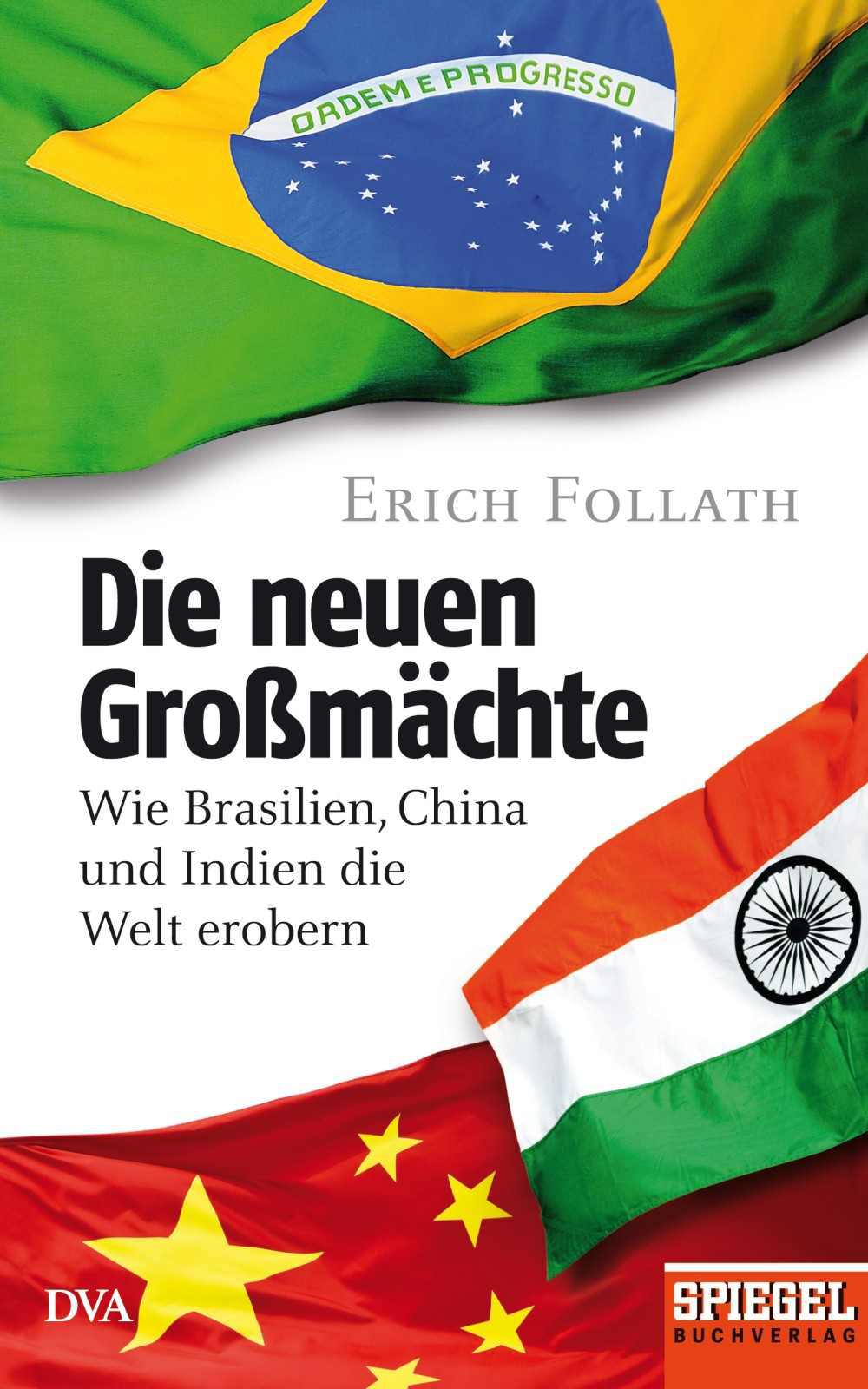![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
verkörpert Hongkong wie kein anderer: den Aufstieg aus bitterer Armut und dem Sumpf der Sweatshops; den Erfolg als billiges Produktionszentrum; den Übergang zur Handels- und Hafenstadt; den Durchbruch zum Banken- und Dienstleistungszentrum; schließlich die jüngste Inkarnation als Cyberport. Wann immer ein Hongkong-Bürger einen Dollar ausgibt, kassiert Li zehn Cent, heißt hier ein geflügeltes Wort. Er gilt als größter privater Vermieter und verkauft mehr technische Geräte als jeder andere. Er besitzt Supermärkte, Drogerien, Anteile am umschlagkräftigsten aller Containerhäfen und Anteile wichtiger Internetportale. Und selbst wenn in der Weltstadt abends die Lichter angeknipst werden, verdient er kräftig mit: Li Ka-shing hält über seine Firmen ein riesiges Aktienpaket der Stromversorger. Der Unternehmer hat nach Berechnungen mancher Finanzexperten stellenweise über 20 Prozent der Marktkapitalisierung der Hongkonger Börse kontrolliert.
Es war ein langer, steiniger Weg an die Spitze. Li Ka-shing, 1928 geboren, geriet mit seiner Familie in die chinesischen Bürgerkriegswirren. Der Vater musste seine Universitätskarriere abbrechen und sich als Nachhilfelehrer verdingen, mehr als eine Mahlzeit pro Tag waren für den Kleinen und seine beiden Geschwister nicht drin. Hunger und Bomben bestimmten den Alltag in Chaozhou, der »Stadt des Phönix«. Li Ka-shing erlebte mit zehn Jahren, wie die Japaner seinem Heimatort immer näher kamen und schon ganze Häuserzeilen niederbrannten. Da entschloss sich die Familie zur Flucht, wählte, wie so viele in diesen Tagen, Hongkong als vermeintlich sicheren Hafen. Doch als der Vater an Tuberkulose erkrankte und starb, war der Junge auf sich allein gestellt. Er verkaufte auf der Straße Uhrenarmbänder. Er diente sich in einer Klitsche für Seifenschalen hoch. Mit zwanzig managte er die kleine Fabrik, heiratete die Tochter des Besitzers. Er arbeitete, wie er sagt, »16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche«. Nachts brachte er sich aus einem Grammatikbuch noch Englisch bei. Mit seinem ersten zusammengesparten Geld – etwa 8000 US -Dollar – gründete er 1950 seine erste eigene Firma. Cheung Kong, »Langer Fluss«, nannte er sie, nach der altchinesischen Bezeichnung für den Jangtsekiang. Er stellte zunächst Kämme her, erkannte mit seinem Unternehmergespür aber bald, dass ein anderes Produkt größere Marktchancen hatte: Li Ka-shing wurde der »König der Plastikblumen«.
Und dann profitierte der Erzkapitalist erstmals von den Kommunisten. Die Kulturrevolution auf dem Festland trieb Ende der Sechzigerjahre in der britischen Kronkolonie die Preise in den Keller. Kaum einer mochte angesichts der in der Innenstadt Hongkongs randalierenden Rotgardisten an eine blühende Zukunft glauben. Li aber forcierte sein Grundstücksgeschäft. Hatte er einen Deal mit Gewinn abgeschlossen, erwarb er Land oder Apartments in besserer Lage – alles per Handschlag. Was so gentlemanlike aussah, war knallhart kalkuliert: Lis »Leutnants« überprüften im Geheimen, wie kreditwürdig die Käufer waren, und drängten wohl auch die eine oder andere notleidende Familie ultimativ zur Wohnungsaufgabe. 1979 war der Selfmademan bereits der größte private Grundstückseigner in Hongkong, was ihm noch fehlte, war der große gesellschaftliche Durchbruch. Der kam mit einem sensationellen Coup: Li erwarb 1979 mit geheimen Deals und viel Geschick die Kontrolle von Hutchison Whampoa, einem der großen britischen Handelshäuser Hongkongs – und wurde so über Nacht zum Gegenspieler von Jardine Matheson, den Erben der Opiumhändler. Ein psychologischer Durchbruch, der auch in Peking für Aufsehen sorgte. Deng Xiaoping lud Li ein, der Erfolgreiche aus Hongkong wurde ins Direktorium des volkschinesischen Investment-Unternehmens Citic berufen: Ehre und Verpflichtung zugleich.
Li investierte großzügig in der Volksrepublik, er sei »der Stolz der chinesischen Nation«, schrieb eine Pekinger KP -Zeitung, Parteichef Jiang Zemin nannte ihn einen »wahren Patrioten«. Politisch hielt er sich bedeckt, er war kein Patriot, der für demokratische Umwälzungen eintrat. Als die Partei am 4. Juni 1989 Panzer gegen die demonstrierenden Studenten einsetzte und ein Blutbad anrichtete, duckte er sich weg. »Natürlich hat mich das traurig gemacht«, sagte er im Interview. »Aber China ist meine Heimat. Was immer geschehen ist, ich werde weiter für eine besser Zukunft meines Landes arbeiten.« 1992 erhielt er die
Weitere Kostenlose Bücher