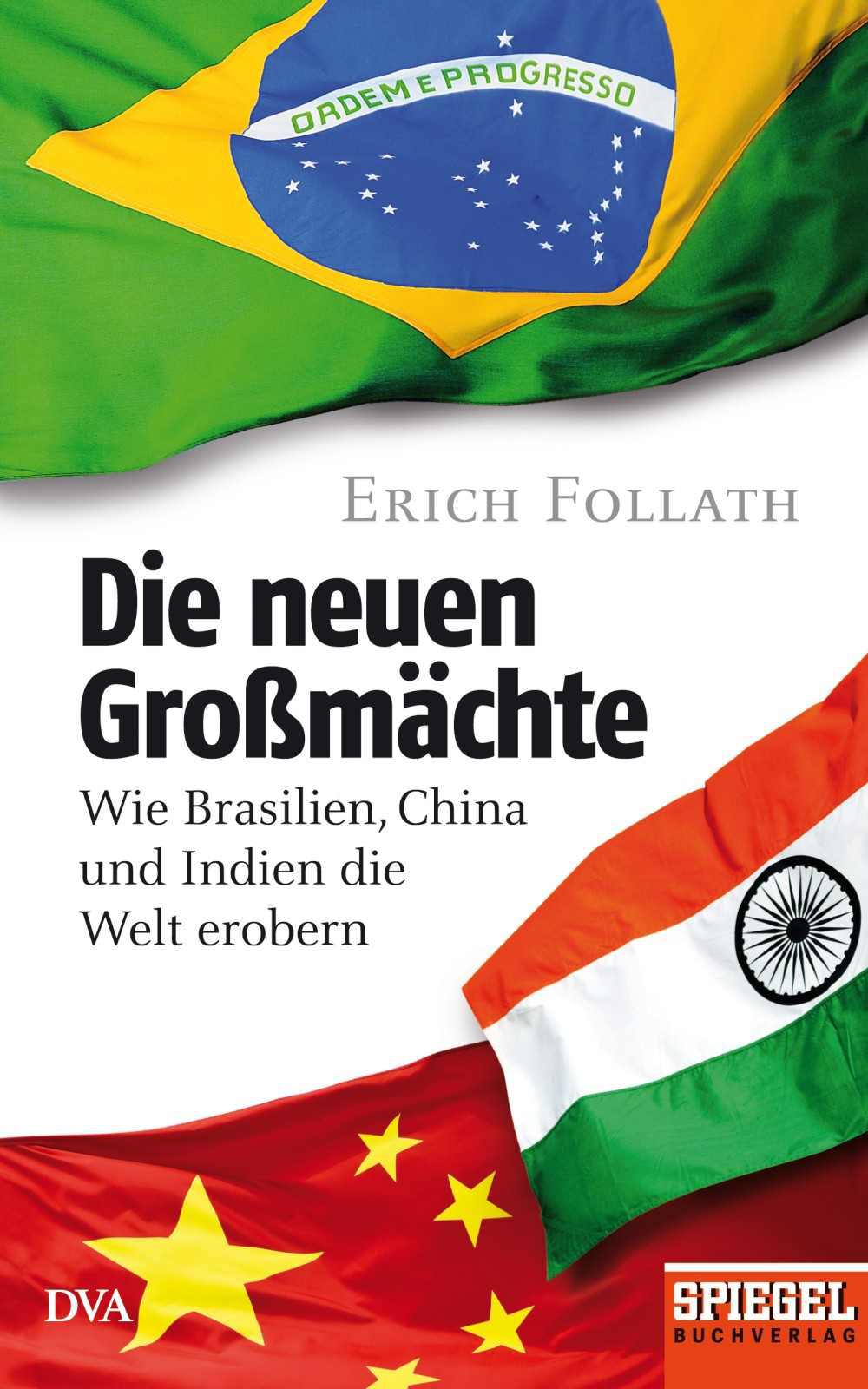![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
achteten vielmehr darauf, die Preise für Grundgüter wie Lebensmittel, Speiseöl und Petroleumprodukte weiterhin zu kontrollieren. Schon aus Eigennutz, um die Wähler nicht zu sehr zu verschrecken; wohl aber auch aus Überzeugung, um Massenentlassungen zu verhindern und menschliches Leid unter den Ärmsten zu lindern. Das war und ist in Indien immer eine Gratwanderung. In zwei entscheidenden Bereichen aber passierte so gut wie gar nichts: im maroden Gesundheits- und Bildungssystem. Und politisch läutete Rao das indische Zeitalter der Koalitionsregierungen ein, eine zunehmende Zersplitterung und Regionalisierung, die der Korruption mehr Tore öffnen sollte als je zuvor.
Aber über Jahre sah es so aus, als könnten Wunder geschehen, als seien Kräfte frei geworden, die das Land in eine rosige Zukunft katapultieren könnten. Indien begab sich auf eine Aufholjagd und erwirtschaftete Zuwachsraten, die an die der Volksrepublik China herankamen. Und gerade weil nun das private Unternehmertum entfesselt war, konnte sich das erfinderische Potenzial entfalten. Fast aus dem Nichts entstanden Weltfirmen. Die Computeringenieure kommunizierten über Datenautobahnen, die miserable »klassische« Infrastruktur des Landes mit ihren holprigen Straßen, den maroden Flughäfen, den unpünktlichen Zügen fiel nicht mehr so ins Gewicht. Städte wie Bangalore und Hyderabad verwandelten sich binnen weniger Jahre zu Hightech-Zentren: Software statt Spinnrad, Bill Gates statt Mahatma Gandhi. Und bei der Entwicklung ihrer Weltklassefirmen brauchten die »neuen Maharadschas« noch nicht einmal westliches Kapital, sie konnten die Finanzmärkte in New York und London ignorieren.
Zwei der Erfolgsunternehmer ragten besonders heraus: Zum einen der Studienabbrecher Azim Premji, der die kleine Klitsche seines Vaters – er handelte mit Speiseöl – auf Softwareprodukte umstellte und die Wipro Corporation mit seinen hochmotivierten und bestens ausgebildeten Ingenieuren an die internationale Spitze führte. Die Kurse des börsennotierten Unternehmens stiegen in so abenteuerliche Höhen, dass Forbes Premji um die Jahrtausendwende auf Platz drei der reichsten Männer der Welt führte (hinter Bill Gates und Warren Buffett, aber vor allen Europäern, Lateinamerikanern und Chinesen). Der Spross einer muslimischen Mittelschichtsfamilie sah sich aber immer auch in der sozialen Pflicht. Er wollte etwas von seinem Reichtum abgeben, in die Zukunft des Landes zu investieren. Der Schlüssel lag seiner Meinung nach in der Bildung, in den Aufstiegschancen für junge Menschen. Premji sorgte für zahlreiche Stipendien und gründete eine eigene Universität; kürzlich unterzeichnete er das von Warren Buffett und Bill Gates angeregte »The Giving Pledge«, mit dem Milliardäre versprechen, sich zugunsten von Hilfsprojekten nach Möglichkeit von mindestens der Hälfte ihres Vermögens zu trennen.
Der andere Unternehmer, für mich bei meinen Indien-Besuchen als Person noch eindrucksvoller, ist der frühere Marxist und Computeringenieur Narayana Murthy. Premji und er haben sich in Bombay kennengelernt und gemeinsam beobachtet, wie IBM den indischen Markt mit minderwertigen elektronischen Massenwaren zuschüttete, die der US -Multi anderswo nicht mehr losschlagen konnte; 1988 wurde IBM von der Regierung in Neu-Delhi des Landes verwiesen. »Es entstand eine Lücke, die wir zu füllen gedachten«, sagt Murthy schlicht.
Anfangs wollte er gemeinsam mit seinem Freund Premji in einer Firma den Markt aufrollen, dann aber ging jeder seinen eigenen Weg – mit dem gegenseitigen Versprechen, sich einmal monatlich zu treffen und auszutauschen, was immer auch passierte. 1981 gründete Murthy mit 3000 Dollar Startkapital, von seiner Frau und sechs Freunden geliehen, die IT -Firma Infosys, da war er gerade 35 Jahre alt geworden. Die ersten Jahre waren hart. Die Bürokratie warf den Jungunternehmern Knüppel in den Weg, wo sie nur konnte. Jede Geschäftsreise ins Ausland bedurfte einer Genehmigung, an Devisen für einen Technologietransfer war nicht zu denken. Auf nationalem Niveau feierte Murthys Firma kleine Erfolge, 1991 zählte sie 170 Mitarbeiter. Aber erst als sich in jenem Jahr die Wirtschaft öffnete, ging es wirklich steil bergauf. Murthy konnte nun für Firmen in den USA und Europa Programme entwerfen und sich mit seinen hervorragend ausgebildeten indischen Softwarespezialisten als Dienstleister anbieten. Binnen weniger Jahre wurde Infosys zu einem Weltunternehmen und an
Weitere Kostenlose Bücher