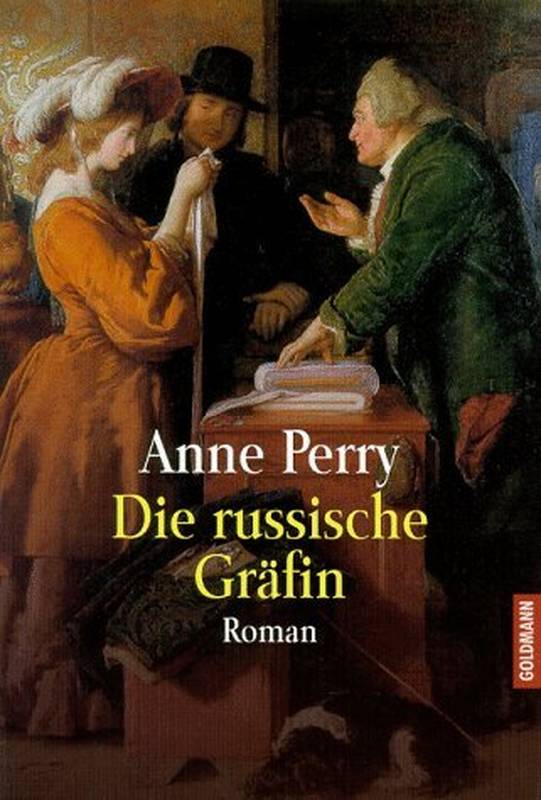![Die russische Gräfin]()
Die russische Gräfin
weil er gezwungen wurde, seine Überzeugungen vor aller Welt auszubreiten. Aber er zierte sich nicht. »Graf von Seidlitz unter Umständen.«
»Weil er für die Vereinigung war?« Harvester zog die Augenbrauen hoch. »Ist es denn so wahrscheinlich, daß Prinz Friedrich sie ohne weiteres verhindert hätte? In Ihren ersten Antworten klang das noch weitaus problematischer. Ich wußte nicht, daß er immer noch soviel Einfluß hatte.«
»Auf Dauer hätte er uns die Unabhängigkeit vielleicht nicht erhalten können«, erklärte Stephan geduldig. »Es wäre aber wohl zu einem Krieg gekommen, und genau davor hatte von Seidlitz Angst. Er hat zuviel zu verlieren.«
Harvester zeigte sich verwirrt. »Ist das denn nicht bei allen der Fall?« Und als wolle er seine Verwunderung mit den Zuschauern teilen, drehte er sich zu ihnen um.
Stephan holte tief Luft. »Selbstverständlich. Der Unterschied ist nur, daß viele von uns glauben, daß wir etwas zu gewinnen, oder genauer gesagt, zu erhalten haben.«
»Ihre Identität als unabhängiger Staat?« Harvester fragte nicht in spöttischem oder respektlosem Ton, sondern bohrte mit unbarmherziger Nüchternheit nach. »Ist sie Ihnen wirklich einen Krieg wert, Baron von Emden?« Er breitete verständnislos die Arme aus. »Wer verliert dann Hab und Gut? Wer stirbt? Ich halte den Wunsch, seinem Land einen Krieg zu ersparen, nicht für so schändlich, selbst wenn es natürlich ein gräßliches Verbrechen ist, deswegen den eigenen Prinzen zu ermorden. Zumindest könnte ich mir vorstellen, daß noch mehr Menschen hier den Wunsch nach Frieden gut verstehen können.«
In Stephans Gesicht glühte auf einmal die Leidenschaft, die er bislang hatte zügeln können. »Vielleicht«, räumte er ein. »Aber schließlich leben Sie alle hier in England, wo es eine konstitutionelle Monarchie gibt, ein Parlament, in dem offen debattiert wird, ein Wahlrecht, das es den Männern erlaubt, für die Regierung zu stimmen, die sie für die beste halten, und Sie haben die Freiheit, zu lesen und zu schreiben, was Ihnen beliebt.« Er sprach ohne Gesten, doch sein Blick umfaßte alle Anwesenden. »Sie haben Rede und Versammlungsfreiheit und das Recht, Ihre Regierung und deren Gesetze zu kritisieren. Sie können Fragen stellen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Sie können politische Parteien gründen mit Zielen, die Sie selbst bestimmen. Sie können jeden Gott auf jede beliebige Weise anbeten. Ihre Armee gehorcht Ihren Politikern und nicht umgekehrt. Ihre Königin würde nie Befehle von ihren Generälen entgegennehmen. Sie sind dazu da, Ihr Land zu schützen und nicht über schwächere und weniger begünstigte Nationen herzufallen, und auf keinen Fall reißen sie die Herrschaft an sich, wenn Sie in großer Zahl aufmarschieren und gegen Ihren Staat, die Arbeitsgesetze, die Löhne oder die Lebensbedingungen protestieren.«
Im Saal war es mucksmäuschenstill, Hunderte von Augen starrten Stephan verblüfft an.
»Wenn Sie in einem der deutschen Staaten lebten«, fuhr Stephan mit vor Trauer rauher Stimme fort, »und noch in Erinnerung hätten, wie vor zehn Jahren die Armee durch die Straßen zog, während die Leute auf die Barrikaden gingen, weil die Hoffnung aufgekeimt war, daß auch wir die Freiheiten genießen könnten, von denen Sie so geringschätzig sprechen, und wenn Sie dann gesehen hätten, wie die Leute starben, wie viele Versprechen gebrochen wurden und Hoffnung in Verzweiflung endete, dann wären Sie bestimmt auch bereit, für die kleinen Freiheiten zu kämpfen, die Felzburg noch hat.« Er beugte sich über das Geländer. »Und im Gedenken an diejenigen, die anderswo im Freiheitskampf gestorben sind, würden auch Sie Ihr Leben hingeben…, für Ihre Kinder und Kindeskinder, für Ihr Land oder für die Zukunft, ganz einfach, weil Sie daran glaubten.«
Die Stille dröhnte förmlich in den Ohren, als er verstummte.
»Bravo!« rief jemand in der Galerie. »Bravo, Sir!«
Ein Dutzend Männer schlossen sich dem Ruf an und standen einer nach dem anderen auf. Immer mehr ließen sich von ihnen anstecken, bis schließlich gut hundert Zuschauer begeistert die Hände hochreckten und »Bravo!« schrien.
»Gott schütze die Königin!« rief eine Frau, und eine andere tat es ihr gleich.
Der Richter schlug nicht mit dem Hammer aufs Pult und machte auch sonst keine Anstalten, für Ordnung zu sorgen. Er wartete ganz einfach, bis die Aufregung sich von selbst legte. Als wieder Ruhe herrschte, fragte er gelassen:
Weitere Kostenlose Bücher