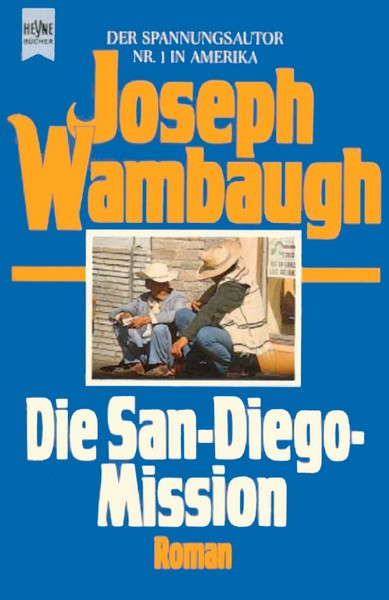![Die San-Diego-Mission]()
Die San-Diego-Mission
Folgezeit ungeheuer viel Wirbel um die verletzten Revolverhelden. Gleich am nächsten Tag hatte Joe Castillo, dessen Heldentaten von allen Zeitungen und Fernsehstationen verbreitet worden waren, seine liebe Mühe und Not, fremde Menschen von seiner Station fernzuhalten. Gott ja, sogar aus seinem Bett rauszuhalten!
Wahr und wahrhaftig kreuzte schon vor seiner Frau und sogar vor der regulären Visite eins jener Lehrerinnen-Groupies aus dem Anchor Inn bei ihm auf, himmelte ihn an, als wäre er Warren Beatty persönlich oder sonst wer von diesen Stars, und fragte an, ob sie ihm nicht eben mal einen blasen solle. Hier und auf der Stelle!
Während der junge Joe Castillo noch damit beschäftigt war, aus einem so erfreulichen Aspekt seiner Popularität tatsächlich Honig zu saugen, veranstaltete ein Fernsehteam auf dem Flur ein ziemliches Tohuwabohu, und eine Krankenschwester kam rein und fragte, ob der Revolverheld von der Grenze mit einem Liveinterview einverstanden sei.
»Zum Henker, nein!« sagte er. »Jagen Sie sie weg!«
Die Lehrerin konnte es nicht glauben. »Du willst auf einen Fernsehauftritt verzichten? Bist du so berühmt?« Dann wollte sie ihm erst recht einen blasen!
Und das war nicht mal der halbe Trubel. Sein Telefon hörte gar nicht mehr auf zu läuten. Sämtliche Kellnerinnen aus sämtlichen Schnellimbissen und sämtlichen Kaschemmen in South Bay erkundigten sich, ob er dieser eine Stämmige sei oder etwa dieser Starke oder dieser Verrückte oder vielleicht … Jesus Christus, es interessierte sie anscheinend einen Scheiß, um welchen Barfer es ging, Hauptsache, sie durften vorbeikommen und ihn besuchen.
Es war ein ganz hübscher Brocken für einen vierundzwanzigjährigen Jungen, damit fertigzuwerden, daß er derartig im Mittelpunkt stand. Es war ihm nie bewußt gewesen, daß er die Verkörperung einer amerikanischen Legende war, ein gottgefälliger, die Gangster jagender, hochberühmter, aus der Hüfte schießender Revolverheld.
Er wußte bloß, daß ihm offenkundig alle Mädchen einen blasen wollten.
Und daß seine Ehe derzeit ziemlich am Arsch war. Die halbe Zeit war er betrunken, und ansonsten trieb er sich draußen in den Canyons rum oder stellte mit den anderen Barfern, die von amerikanischer Mythologie ebensowenig Ahnung hatten wie er, San Diego auf den Kopf. Und dabei hatte er wahrscheinlich die liebste, verständnisvollste und ganz fraglos hübscheste Frau von allen. Er war auf dem besten Weg, ihr fürchterlich weh zu tun, obgleich er wußte, daß ihm das Herz brechen würde, wenn sie weinte.
Joe Castillo fragte sich, ob die Situation nicht sehr viel einfacher sein würde, wenn er statt mit einer Mexikanerin mit einer Weißen verheiratet wäre, die ihn, wie es Jan Gil sicher längst getan hätte, regelmäßig in den Hintern treten und einen Mordskrach schlagen würde, wenn er es verdient hatte. So führte die Tatsache, daß er ein echter, lebender Revolverheld war, dazu, daß der junge Cop reuig und total verwirrt war und äußerst zwiespältige Gefühle hatte.
Und es gab noch was – seine Hand. Momentan war sie natürlich richtig kaputt. Aber er hatte Angst, daß sie nie wieder richtig heil werden würde. Wenn ihn gerade mal keiner besuchte, kriegte er Depressionen, weil die Hand gar nicht mehr so hübsch und beweglich war wie vorher und er auch merkte, wie schwierig es war, ohne eine so bewegliche Hand zu reden. Und er sah seinen Zimmergenossen im Bett nebenan und klagte: »Ich bin erst vierundzwanzig. Was mach ich bloß, zum Henker? Etwa schon in Pension gehen?«
Dann rief er sich zur Ordnung und dachte darüber nach, wie sich das wohl anhörte. Sein Zimmergenosse war erst sechzehn, und wegen einer Krebserkrankung hatten sie ihm ein Bein abgenommen.
Daraufhin flüchtete sich Joe Castillo in seinen Lieblingsausdruck, den er zu gebrauchen pflegte, wenn er sich selber anklagte, und sagte: »Meine Scheiße stinkt! Tut mir leid, tut mir leid!«
Aber seinen Zimmergenossen störte das gar nicht. Der Junge war völlig ausgeflippt, nachdem er alles über Joe Castillo in den Zeitungen gelesen und ihn außerdem im Fernsehen bewundert hatte. Der Junge hatte begriffen, daß ihm der erste Revolverheld Gesellschaft leistete, den er je gesehen hatte. Der Junge zog sich mühsam aus dem Bett, versuchte, auf einem Bein zu stehen, das gar nicht mehr da war, nahm Anrufe für Joe entgegen und erledigte auch sonst alles mögliche für ihn. Der Junge fragte den Arzt, ob er wirklich, wie vorgesehen, am
Weitere Kostenlose Bücher