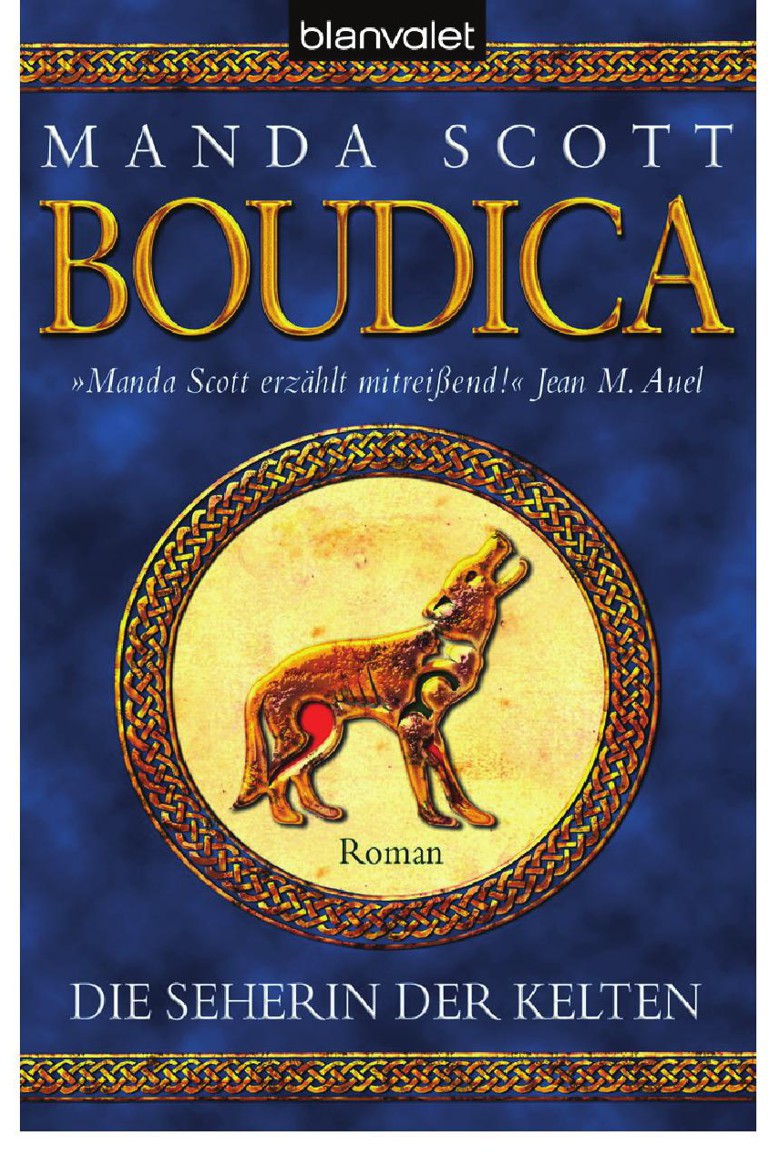![Die Seherin der Kelten]()
Die Seherin der Kelten
leichte Aufgabe. Er hätte dringend zwei Leute gebrauchen können, die ihm halfen, um die Stute auf die Seite zu drehen, während Valerius deren Gebärmutter in die andere Richtung drehte. Er überlegte, ob er zu der kleinen Gruppe von Häusern hinunterlaufen sollte, um dort eine der ruhigen, nur schwer zu erschütternden Frauen zu wecken, die sich mit der Geburt mindestens genauso gut auskannten wie er. Und für Bellos hätte er seinen Stolz auch tatsächlich geopfert. Aber den ganzen weiten Weg hinunterzulaufen, eine der Frauen aus dem Schlaf zu rütteln und wieder hier heraufzuwandern würde bis zum Morgen dauern, und Valerius glaubte nicht, dass die Stute den Sonnenaufgang noch erleben würde. Er kämpfte nun also ganz auf sich allein gestellt, schwitzte und fluchte. Das alles unterschied sich kein bisschen von dem Kampf in einer Schlacht, außer dass die Stute nicht versuchte, ihn zu töten, sondern sich nur stöhnend hin und her wand und sich unter Qualen bemühte, ein Fohlen zu gebären, dem der Weg in die Freiheit noch nicht offen stand.
»Bitte... dreh dich jetzt gemeinsam mit mir herum... jetzt... drehen!«
Die Stute keuchte und schnaufte und trat um sich, keilte mit beiden Hinterhufen aus und rammte dabei mit ihren Hinterbacken Valerius’ Kopf und Schulter, so dass sein Gesicht auf höchst unsanfte Weise in den nassen Torfboden gedrückt wurde. Durch seinen Arm schoss ein Brennen und ein eisiges Schaudern und dann wieder ein Brennen, und eine alte Wunde an seiner Schulter schien in neu erwachtem Schmerz geradezu aufzuschreien. Er stemmte die Ellenbogen in die Erde und drückte mit ausgestreckten Fingern, und endlich, auf geradezu wundersame Weise, schien das Fohlen unmittelbar davor, sich zu drehen, glitt schließlich träge in die andere Richtung und öffnete den Gebärmutterhals.
»Danke... danke. Warte, es ist noch nicht vorbei. Lass mich kurz nachdenken. Gib mir einen Augenblick Zeit zum Nachdenken.«
Er lag flach auf dem Moorboden, sog die Luft mit den gleichen, keuchenden Zügen ein wie zuvor die Stute. Er weinte vor Erschöpfung, vor lauter Erleichterung, dass die Strapazen endlich ein Ende hatten. Valerius wünschte sich, dass Bellos sehen könnte, was er gerade vollbracht hatte und was noch vor ihm lag, doch er wusste nicht, wie er ihm dies mitteilen sollte. Der Junge war zwar zwischenzeitlich noch nicht wieder auf wundersame Weise ins Leben zurückgekehrt - andererseits, wie Valerius feststellte, als er zwischendurch rasch zu der Schmiedehütte rannte, um nach Bellos zu sehen, war der Junge aber auch noch nicht von ihm gegangen.
Als Valerius zurückkehrte, legte er sich erneut neben die Stute auf den Boden. Er tätschelte ihr sanft den Rumpf und sprach mit ihr genauso, wie er auch mit einer in den Wehen liegenden Frau gesprochen hätte. »Das Schlimmste hast du jetzt hinter dir. Lass mich mal tasten, wie das Fohlen jetzt liegt. Dann holen wir es heraus, und du kannst dich endlich ausruhen.«
Das Fohlen: jenes schwarz-weiße Phantom, das eines Tages im Herbst in Valerius’ Träume gestürmt war und das sie seitdem so vollkommen ausfüllte, dass es alles andere verdrängte. Luain mac Calma, der älteste Träumer von Mona, hatte die Saat mit solch beiläufiger Leichtigkeit ausgestreut, dass es schwer war, das Ganze nicht für einen sehr bewussten Akt zu halten. Airmid meint, es wird ein Hengstfohlen, schwarz und weiß gescheckt und mit einer Blesse in der Form eines Schildes und eines Speers auf der Stirn.
Valerius hatte ihm damals widersprochen und erwidert: »Dieser Traum lebt schon lange nicht mehr.« Zu jenem Zeitpunkt hatte er das auch in der Tat geglaubt. Erst später in der Nacht war die Wahrheit hervorgetreten, und dann noch einmal in den darauf folgenden Nächten, und schließlich erschien sie ihm jede Nacht, bis er sie auch am Tage erkannte, und er musste sich sehr anstrengen, einen klaren Kopf zu behalten, um weiterhin seine Aufgaben als Schmied erfüllen zu können oder seine Verpflichtungen als Heiler, oder um die Lederarbeiten zu erledigen, oder um einfach nur das Essen zu kochen für sich und den belgischen Jungen, der einst ein Sklave gewesen war. Jener Junge, der sich in eine betagte Kavalleriestute verliebt hatte und der höchstens einmal einen flüchtigen Gedanken an das Fohlen verschwendete, das sie in sich trug.
Doch Bellos’ Träume waren nicht Valerius’ Träume, und der Mann hatte dem Jungen nie das Wesen der ersten echten Vision seiner Kindheit erklärt, jener
Weitere Kostenlose Bücher