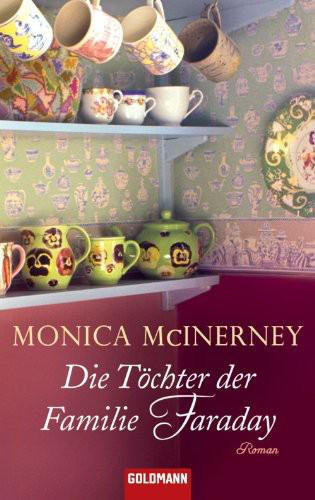![Die Toechter der Familie Faraday]()
Die Toechter der Familie Faraday
anstatt Amerikanern die Jobs wegzunehmen.«
»Mich hat sie gefragt, ob ich schwul wäre, und als ich verneint habe, hat sie gesagt, ich sähe aber so aus mit meiner gekünstelten Haarfarbe. Und als ich ihr gesagt habe, dass mir meine Frisur herzlich egal und mein Haar von ganz allein und ganz plötzlich grau geworden ist, hat sie mich ausgeschimpft und gesagt, ich müsste mehr auf mein Äußeres achten, sonst würde ich nie eine Frau abbekommen.«
Sie tranken beide einen kleinen Schluck, dann sprachen sie im gleichen Moment.
»Was hat Sie nach New York verschlagen?«, fragte Gabriel.
»Wie lange arbeiten Sie schon als Musiker?«, fragte Maggie.
Sie lachten. »Sie zuerst«, sagten sie wieder im Chor.
»Werfen wir eine Münze«, schlug er vor. »Kopf oder Zahl?«
Sie wählte Zahl. Es kam Zahl. »Nach dem Intro sollte ich Ihnen eine philosophische, existentielle Frage stellen. Wie lange also sind Sie schon Musiker?«
»Ich bin nicht wirklich Musiker. Im Moment jobbe ich nur nebenher.«
»Was machen Sie denn sonst?«
»Ich bin Kameramann. Nachrichten und aktuelles Zeitgeschehen. Ich habe in einem Studio gelernt, dann habe ich draußen auf der Straße gearbeitet.«
»Aber das tun Sie nicht mehr?«
»Im Moment nicht, nein. Und was ist mit Ihnen? Hatten Sie ein Leben vor Ihrem Dasein als Mietenkelin?«
»Ich war Controllerin in einem großen Unternehmen in London. Oder, wie Dolly es ausgedrückt hat, bessere Buchhalterin.«
»Bis Sie sich eines Morgens überlegt haben, dass Sie lieber in New York leben würden. Also haben Sie die Bücher manipuliert, eine Million Dollar geklaut und nun sind Sie hier?«
»Nicht ganz.« Zu ihrer eigenen Überraschung erzählte sie ihm, was passiert war. Sogar noch ausführlicher als Dolly. Der Whiskey löste ihr die Zunge. Nach Wochen, in denen sie versucht hatte, es aus ihren Gedanken zu verbannen, erzählte sie die Sache nun zum zweiten Mal an ein und demselben Tag. Sie schilderte den entsetzlichen Moment, als die Waffe zum Vorschein gekommen war, den Ausdruck in den Augen des Mannes, als er sich die Waffe an die Schläfe gesetzt hatte. Der Geruch von Schießpulver, das Geschrei ringsumher – das ließ sich am schwersten verdrängen. Auf ihrer Jacke, die auf dem Stuhl neben ihr gehangen hatte, war etwas Blut gelandet. Sie hatte es erst Stunden später bemerkt, nachdem der Notarzt und die Polizei gegangen waren. Sie hatte die Jacke gleich in den Müll geworfen.
»Tut es Ihnen leid, dass Sie gekündigt haben?«
Das hatte noch niemand gefragt. Sie schüttelte den Kopf. »Ich hätte nicht bleiben können. Mir ist zwar immer wieder gesagt worden, dass es nicht direkt mit mir zu tun hatte, aber mir kam es so vor. Kommt es immer noch. Ich habe das Gefühl, als wäre es meine Schuld.«
»Das kann ich nachvollziehen.«
Endlich, endlich Verständnis. »Danke.«
»Aber trotzdem haben Sie unrecht. Es war nicht Ihre Schuld.«
»Das glaube ich aber. Mir war niemals bewusst, dass meine Spielerei mit Zahlen wirklich Einfluss auf das Leben anderer hatte.«
»Spielerei? So haben Sie Ihre Arbeit gesehen?«
Sie nickte. »Ich habe die Arbeit mit Zahlen geliebt. Alles, was mit Mathematik zu tun hat.«
»Sie sagen, Sie haben die Arbeit geliebt. Jetzt also nicht mehr?«
Sie rieb sich die Nase. »Ich weiß es nicht. Ich habe mich entschieden, eine Weile nicht mehr auf diesem Gebiet zu arbeiten. Jedenfalls nicht, solange ich hier bin.«
»Aber es muss doch sehr viel geben, was Sie tun könnten, oder? Es gibt doch bestimmt großen Bedarf an Leuten, die Zahlen und Mathe lieben. Ich kenne niemanden.«
»Ich war natürlich immer ein Kuriosum, besonders in der Schule. Aber ich habe mich noch nicht entschieden, was ich tun werde. Im Moment lebe ich von meinen Ersparnissen. Wenn die zur Neige gehen, werden wir sehen.«
Er nickte. »Sie reiben sich häufig die Nase, wenn Sie sprechen. Wissen Sie das?«
Sie ließ peinlich berührt den Arm sinken. »Meine Mutter hat immer gesagt, ich würde mir eines Tages noch die Nasenspitze abreiben. Ich mache das immer, wenn ich über etwas nachgrüble.«
»Das ist also ein gutes Zeichen? Ich bin also ein ernsthafter, anregender Gesprächspartner? Das ist beruhigend.«
Sie sprachen über seine Musik. Er erzählte ihr, welche Songs er spielte – typisch irische Balladen, Bob Dylan, Cat Stevens, die Klassiker. Sie fragte ihn, wie lange er schon Gitarre spielte. Seit seinem zwölften Geburtstag, sagte er, seit einundzwanzig Jahren. Wie war es, in Bars zu
Weitere Kostenlose Bücher