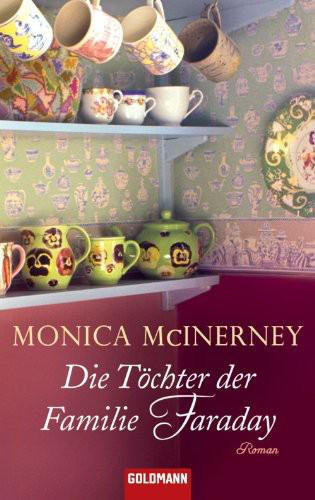![Die Toechter der Familie Faraday]()
Die Toechter der Familie Faraday
Stunden später gehen.
»Du wirst mir fehlen«, sagte Mark. Er lag auf dem Bett und schaute zu, wie Eliza die letzten Sachen in den Koffer legte. Er war gleich nach dem Training mit einem seiner Footballteams zu ihr gekommen.
»Ich bin bald wieder hier. Es ist doch nur eine Woche.«
»Du wirst mir trotzdem fehlen.«
»Du sentimentaler Trottel.« Sie lächelte.
»Warum hast du dich eigentlich umentschieden?«
»Mir ist aufgegangen, dass ich mir doch ein paar Tage freinehmen kann und mein Vater auch nicht jünger wird.« Sie beließ es dabei. Sie hatte sich Mark gegenüber niemals näher über ihre Familie geäußert. Das gefiel ihr so an ihrer Beziehung. Es ging nur um sie beide, nichts wurde durch andere verkompliziert. Eliza wollte ihre gemeinsame Zeit nicht damit vergeuden, dass sie sich über Leos Schrullen, Juliets Dramen, Mirandas Selbstsüchtigkeit oder Clementines Erfolg ausließ. Sie sprach gelegentlich über Maggie, wahrte aber auch hierbei große Distanz. Maggie hatte Mark in den vielen Jahren, in denen sie bei Eliza gewesen war, nie kennengelernt. Eliza wollte es nicht riskieren. Sie wollte nicht hören, was ihre Familie zu dem Thema zu sagen hätte.
»Bist du endlich mit dem Packen fertig?«
»Beinahe.«
»Ich empfinde es nur als eine Zeitverschwendung, auf dem Bett zu liegen und nichts Besseres zu tun, als dir beim Einpacken von T-Shirts zuzuschauen.«
»Das ist ein Argument.«
Sie nahm den Koffer vom Bett und legte sich zu Mark, schmiegte sich an ihn, drückte ihre Lippen auf seine. Ihr Verlangen nach ihm war ungebrochen. Sie wartete immer darauf, dass es nachließ, doch das geschah nicht.
»Was mache ich, wenn ich das hier brauche, während du weg bist?«
»Du wirst warten müssen, bis ich zurückkomme.« Sie wusste, dass er und seine Frau seit Langem nicht mehr miteinander schliefen. Er hatte es ihr erzählt, und sie glaubte ihm. Mehr oder weniger. Falls sie doch gelegentlich Sex hatten, konnte Eliza ohnehin nichts dagegen tun. Es änderte nichts an dem, was sie mit Mark hatte. »Du zählst die Tage und erwartest mich dann hier, genau so.«
»Ach ja?«
»Ja.«
»Und woher willst du das wissen?«
Sie lächelte. »Weil ich genau weiß, was du willst und was du brauchst, und ich die einzige Person auf der ganzen Welt bin, die dir das geben kann.«
»Ich mag es, wenn du so mit mir redest.«
»Deshalb tue ich es ja«, sagte sie. Ihr nächster Kuss brachte ihn zum Schweigen.
Miranda wachte aus dem Mittagsschlaf auf, streckte und dehnte sich und aalte sich in der warmen Luft. Draußen platschte es laut, einer der anderen Gäste war in den Pool gesprungen oder gestoßen worden. Miranda blieb während der Mittagszeit lieber im Haus. Die griechische Sonne ging mit etwas reiferer Haut nicht gerade gnädig um, selbst wenn sie sorgsam gepflegt war. Nicht dass Miranda den wahren Grund für ihre Siesta jemals in der Öffentlichkeit geäußert hätte.
Sie war vor zwei Tagen angekommen und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, als Erste zu frühstücken, vor zehn Uhr zu schwimmen, sich danach für einige Stunden in ihr Zimmer zurückzuziehen und gegen drei Uhr wieder auf die Terrasse zu gehen, wenn es an der Zeit für einige Drinks und einen kleinen Imbiss war. Die Villa hatte einen beneidenswerten Blick über das Mittelmeer in der einen Richtung und über die weißen Häuser des nahe gelegenen Dorfes in der anderen. Die Aussicht war nicht das einzig Fantastische. George war ein sehr großzügiger Gastgeber. Das Essen war schlicht, aber sensationell: gegrillter Fisch, kreative Salate, frisches Obst, Käse aus der Region, alles von einem sehr talentierten Koch zubereitet, den sie niemals zu Gesicht bekamen. Der Weinkeller war hervorragend bestückt, die Haushälterin ausgesprochen effizient: Mirandas Abendkleidung hing stets frisch gebügelt im Schrank, das Bett wurde täglich mit Laken aus feinster ägyptischer Baumwolle neu bezogen, das Marmorbad glänzte und war mit exklusiven Kosmetikartikeln ausgestattet. Und alles, was George dafür im Gegenzug verlangte, war ein Höchstmaß an geistreicher Unterhaltung – mit möglichst vielen spitzen Bemerkungen.
»Meiner Meinung nach ist das ein fairer Handel, meine liebste Miranda«, hatte er gesagt. »Du erfreust mich mit deinem Anblick und deinen Bonmots, und ich tue alles, um dich glücklich zu machen.«
Eine Schande, dass er schwul war. Trotzdem sorgte George immer dafür, dass es genügend Verehrer gab. Miranda hatte sich unglaublich geschmeichelt
Weitere Kostenlose Bücher