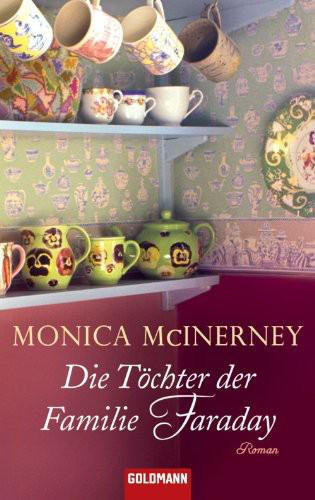![Die Toechter der Familie Faraday]()
Die Toechter der Familie Faraday
Natürlich war das Theater. Miranda war sehr belesen. Erschreckend belesen. Oder vielleicht überhaupt nur erschreckend.
Maggie befühlte das vierte Päckchen. »Frohe Weihnachten, Sadie.« Für Sadie etwas zu finden war immer am schwierigsten. Wie sollte Maggie ein Geschenk für sie kaufen, wenn sie nicht einmal wusste, ob Sadie eine eigene Wohnung hatte? Make-up oder Schmuck kaufen, wenn sie nicht wusste, ob sie so etwas trug? Eine edle Handcreme, denn das konnte ihren Überzeugungen widersprechen? Selbst einen Pullover oder einen netten Schal, denn sie hatte Sadie seit zwanzig Jahren nicht gesehen und wusste nicht, welche Farben sie mochte und welche Größe sie hatte. Das Einzige, was für jemanden blieb, den man nur von einer jährlichen Geburtstagskarte her kannte, waren Briefpapier und schöne Stifte. Maggie hatte beides gekauft, wie in all den Jahren zuvor. »Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Alles Liebe, Maggie«, hatte sie auf die Karte geschrieben. Der gleiche Satz, seit zwanzig Jahren. Und ein kurzer Abriss dessen, was im Laufe des Jahres passiert war.
»Seid ihr sicher, dass Sadie meine Nachrichten überhaupt bekommt?«, hatte sie vor vielen Jahren gefragt. »Woher wollen wir das wissen, wenn wir keine Antwort von ihr bekommen?«
»Sie schickt doch Nachrichten durch Vater Cavalli«, hatte Leo gesagt. »Er lässt uns immer wissen, wie es ihr geht. Und er sagt, dass sie deine Briefe liebt, das weißt du doch.«
Maggie konnte als einziges Mädchen an ihrer Schule eine Tante aufweisen, die durchgebrannt war, um sich einer Hippie-Kommune anzuschließen. Das war eine ziemliche Attraktion. Zwar wurde Maggie von einer Klassenkameradin übertroffen, deren Onkel Nachrichtensprecher beim Fernsehen war, aber dennoch. Maggie hatte oft mit ihren Freundinnen darüber gesprochen.
»Was machen Hippies denn eigentlich?«, hatte eine wissen wollen.
Maggie war nicht sicher. »Sie kümmern sich um Delfine«, hatte sie gesagt, weil Sadie manchmal eine Kette mit einem Delfin-Anhänger getragen hatte.
»Echt? Und was macht man da?«
»Man füttert und putzt sie.«
»Die müssen doch nicht geputzt werden, die sind doch schon im Wasser.«
»Das ist doch Salzwasser. Sadie wäscht sie mit frischem Seifenwasser.« Maggie hatte kurz darauf das Thema gewechselt.
Als Teenager hatte sie Clementine gefragt, ob Sadies Entscheidung in irgendeiner Form mit ihr zu tun hätte. Der Gedanke hatte stets an ihr genagt. Schließlich war Sadie weggegangen, um Hippie zu werden, gleich nachdem sie mehrere Wochen mit Maggie verbracht hatte, als Clementine damals so krank gewesen war. Vielleicht hatte die lange Zeit mit einer fast Sechsjährigen Sadie die Familie restlos verleidet.
»Das hatte wirklich überhaupt nichts mit dir zu tun, Maggie.«
»Glaubst du, sie vermisst uns? Vermisst du sie?«
»Darum geht es nicht. Es ist ihr Leben. Sie muss tun, was sie für richtig hält.«
Maggie sah auf die Uhr. Es wurde Zeit, zur Post zu gehen. Sie packte die Geschenke in die Tüte, das Geschenk für ihre Mutter ganz obenauf.
Es war ein seltsam geformtes Päckchen – darin wie immer ein Durcheinander an verschiedenen Geschenken, wie bei einem Glückstopf. Es machte so viel Spaß, für eine Mutter einzukaufen, die nur siebzehn Jahre älter als man selbst war. Sie hatten in vielem einen ähnlichen Geschmack. Das Hauptgeschenk war dieses Jahr eine alte Brosche, zarter Golddraht mit hellgrünen, roten und orangefarbenen Steinen, in Gestalt eines Pinguins. Maggie schickte ihrer Mutter natürlich immer etwas, das mit Vögeln zu tun hatte. Außerdem bekam auch sie amerikanische Schokolade (Clementine mochte sie ebenso sehr wie Tollpatsch), eine gebrauchte CD mit Opernarien und einige praktische Dinge: warme Socken, warme Unterwäsche, besonders reichhaltige Feuchtigkeitscreme und eine neue Uhr, weil sie ihre alte verloren hatte, als sie »Down South« war, wie Clementine und ihre Kollegen die Antarktis nannten.
Ob Clementine wohl schon wusste, wann ihre nächste Reise anstand? Von London aus hatte Maggie jeden Tag mit ihrer Mutter telefoniert oder gemailt und war immer auf dem Laufenden. In New York versuchte sie, unabhängiger zu sein. Oberflächlich betrachtet kam sie gut zurecht, sie rief nur einmal in der Woche an, schrieb überhaupt keine E-Mails und schickte ganz selten Textnachrichten. Emotional kam sie nicht gut zurecht.
Sie spielte einen Moment lang mit dem Gedanken, das Paket nicht nach Hobart, sondern in die Antarktis zu senden, weil
Weitere Kostenlose Bücher