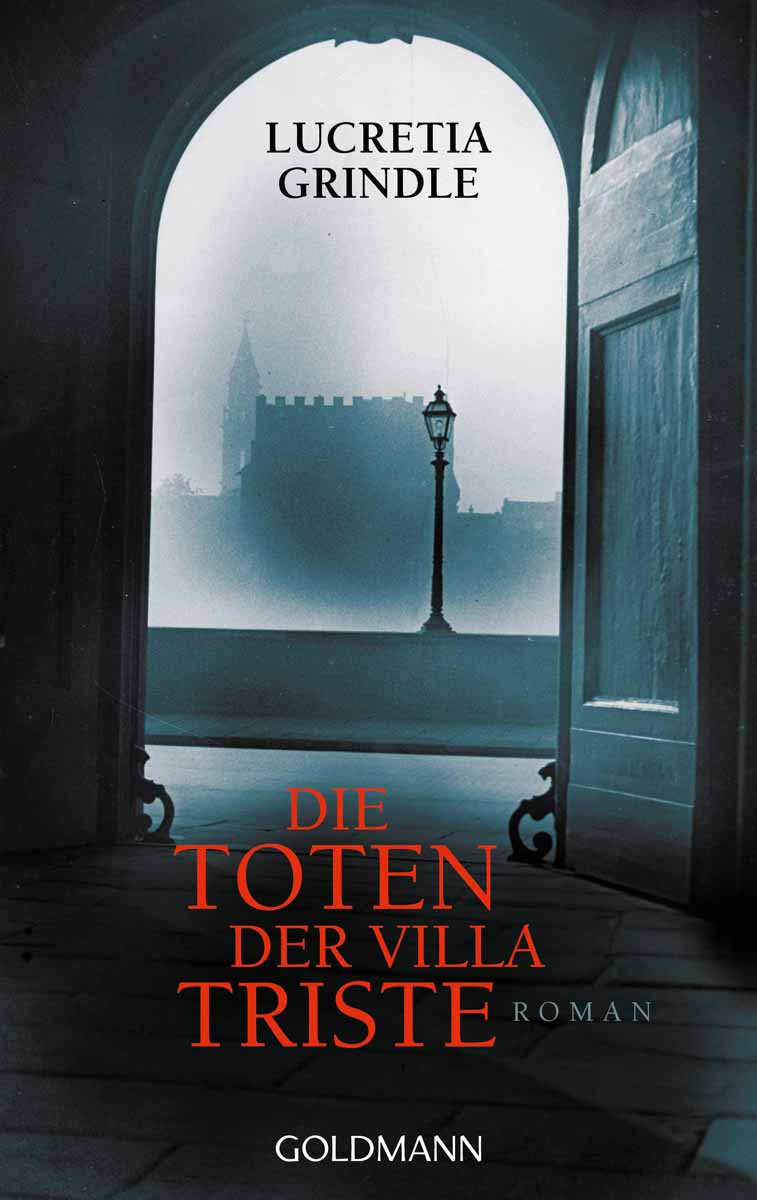![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
ich seit meinen Kindertagen gefürchtet hatte. Und ich wusste, während ich in Hut und Mantel dasaß, dass ich, wenn sich meine Ängste bewahrheiteten – wenn Issa mich wirklich verlassen hätte –, nicht die Kraft hätte weiterzumachen. Ich würde es nicht einmal versuchen.
Ich weiß nicht, wie lange ich so saß, bevor ich aufstand und ins Nebenzimmer ging. Wahrscheinlich war mir kalt geworden, und ich hatte beschlossen, dass ich mich ins Bett legen und dort die Nacht durchwachen würde, bis ich wusste, was mir der nächste Tag brachte. Ich schaltete das Licht nicht ein. Ich setzte mich nur hin und zog die Schuhe aus. Darum sah ich erst, als ich die Decke zurückschlug, das kleine Päckchen auf dem Kissen liegen. Es war in Geschenkpapier gepackt und mit einer Schnur verschlossen, und es machte mich unsagbar glücklich, weil es mir zeigte, dass sie immerhin da gewesen war. Als ich es aufhob, meinte ich, die Berührung ihrer Hand zu spüren.
Zu diesem Weihnachtsfest schenkte mir Issa ein weiteres Buch. Auf die erste Seite hatte sie geschrieben: »Für 1945 – ein neues Jahr und ein neues Leben.«
Etwa drei Wochen danach kam ich abends heim und fand sie in der Küche vor, wo sie wie ein eingesperrter Tiger auf und ab marschierte.
»Sie haben es mir verboten«, erklärte sie wütend. »Sie haben mir verboten weiterzuarbeiten. Sie meinen, es sei zu gefährlich!«
Sie sah mich zornig an, als wäre es allein meine Schuld, dass sie heimgeschickt worden war, um dort ihr Kind zu erwarten. Der Befehl machte sie rasend. Ganz offensichtlich hatte sie widersprochen und sich gewehrt – nicht nur, glaube ich, weil sie »den Kampf nicht aufgeben« wollte, sondern weil sie genau wie ich versuchte, vor der Vergangenheit davonzulaufen. Ich glaube, wir beide fürchteten die Untätigkeit mehr als alle Kugeln oder Bomben – denn wir hatten Angst davor zurückzublicken.
Ich dachte an jenen Tag im September, an dem ich in den Spiegel gesehen und Lots Frau erblickt hatte. Also hatte ich mich doch nicht getäuscht.
An jenem Abend blieben wir auf und spielten Karten. Issa gewann, sie sammelte einen ganzen Haufen Papierschnipsel ein, die wir als Geld verwendeten, und das munterte sie ein wenig auf. Dann, drei Tage später, wurde in den frühen Morgenstunden und ohne Vorwarnung mein Neffe geboren. Issa schrie nur ein einziges Mal auf, und da rief sie nach Carlo.
Issas Kind war ein einziges Wunder. Als ich am nächsten Morgen zur Arbeit gehen musste, starrte sie in sein winziges Gesicht und sah wie verzaubert zu, wie sich die winzigen Händchen um ihre Finger schlossen. Vier Tage später, am Sonntag, tauften wir den Kleinen heimlich. Wir warteten bis Sonnenuntergang, badeten ihn und zogen ihm dann eine meiner weißen Blusen als Taufkleidchen an. Ich hätte gedacht, dass Issa ihn nach Carlo nennen wollte, aber sie schüttelte den Kopf.
»Nein?«, fragte ich. »Bist du dir sicher?«
Sie nickte.
»Ich weiß, wer sein Vater ist.« Sie sah erst ihren Sohn, dann mich an und lächelte – nicht so wie früher, sondern anders, von Trauer umsäumt. »Er wird in einer anderen Welt aufwachsen«, sagte sie. »Das wünsche ich mir für ihn. Carlo würde sich das auch für ihn wünschen. Er sollte mit seinem eigenen Namen sein eigenes Leben beginnen.«
Das neue Buch, das sie mir geschenkt hatte, hatte einen Anhang, in dem alle Namenstage aufgeführt waren. Wir entzifferten mit zusammengekniffenen Augen die winzigen Buchstaben, fanden den richtigen Eintrag und tauften den Kleinen nach dem Heiligen für den Tag seiner Geburt.
Ab da begann sie, sich zu verändern. Anfangs fiel mir das kaum auf. Ich war zu beschäftigt, oft arbeitete ich die Nächte durch. Und Issa, die mit ihrem Sohn zu Hause blieb, lächelte weiter. Sie lachte sogar. Trotzdem hatte sich ein Schatten über sie gelegt. Solange sie als Kurier gearbeitet und gleichzeitig darauf gewartet hatte, dass ihr Kind zur Welt kam, hatte sie sich auf diese beiden Dinge konzentrieren können. Auf das nächste Treffen, auf die Informationen, die sie weitergeben musste, auf Namen und Gesichter. Darauf, am Leben zu bleiben, bis sie Carlos Kind das Leben geschenkt hatte.
Eines Nachmittags kam ich nach Hause und ertappte sie dabei, wie sie am Tisch saß und auf etwas in ihrer Hand starrte. Als ich zu ihr ging, erkannte ich, dass es eine Fotografie war: winzig und mit eselsohrigen Ecken. Offenbar war ich nicht die Einzige, die Dinge in ihren Kleidern zu verstecken verstand. Ohne dass ich gefragt
Weitere Kostenlose Bücher