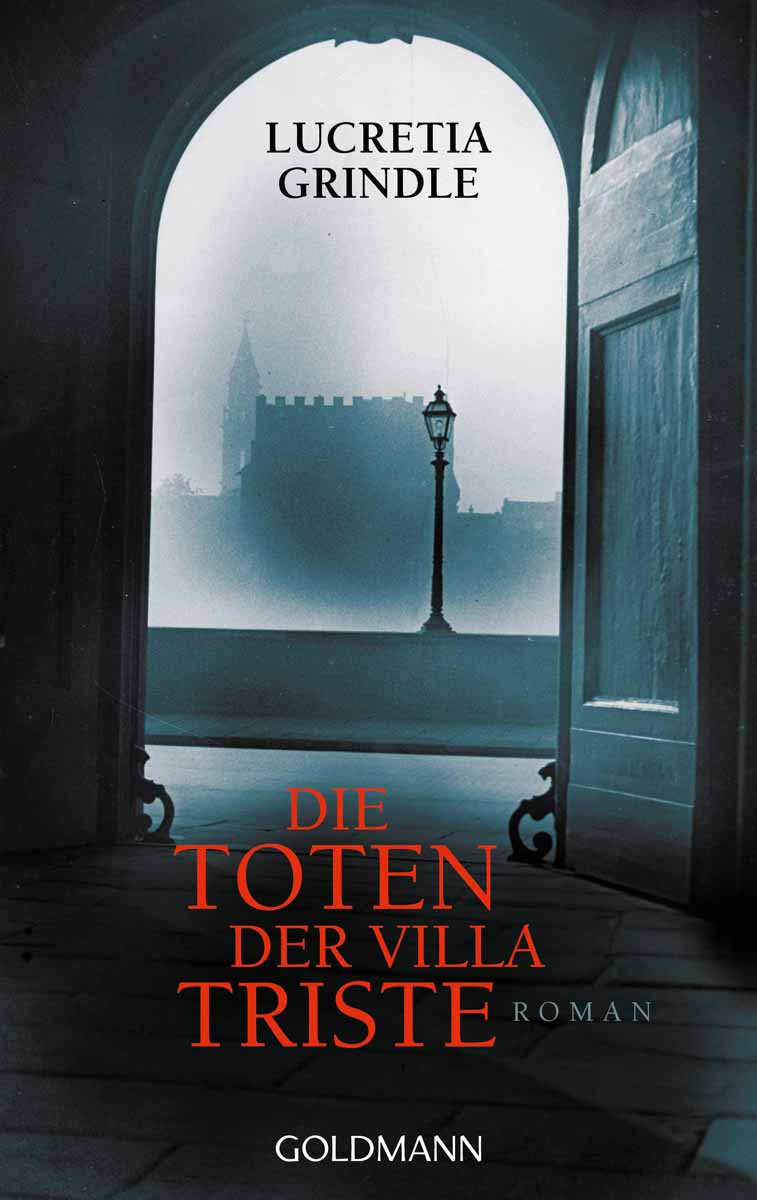![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
hätte, hielt sie mir das Bild hin. Aus ihrem Haarschnitt schloss ich, dass es im Frühling des Vorjahrs aufgenommen worden war, irgendwo in den Bergen, wahrscheinlich ungefähr zu der Zeit, als sie herausgefunden hatte, dass sie schwanger war. Sie stand mit Carlo auf einer Wiese. Sie hielten sich in den Armen und sahen ungeheuer glücklich aus. Und ungeheuer jung. Sie strich mit dem Finger über das Bild.
»Ich hatte ja keine Ahnung«, sagte sie. »Solange ich mit ihm zusammen war, hatte ich keine Ahnung, wie sehr ich ihn liebte.«
Ich hielt die Einkäufe in den Händen, die dürftigen Krumen, die ich mit unseren Lebensmittelkarten zusammengekratzt hatte, aber ich hatte sie völlig vergessen, als ich Issa so sah. Plötzlich konnte ich nur noch daran denken, was ich ihr angetan hatte. Was ich Carlo und Mama und Papa und Rico angetan hatte. Uns allen. Allen, die an jenem Tag dabei gewesen waren, und auch dem Kind, das jetzt aufgewacht war und strampelnd nach seiner Mutter fassen wollte – dem einzigen Elternteil, den es je kennen würde, nur weil ich damals nicht vorsichtig genug gewesen war.
Issa schob das Bild in die Tasche, stand auf und ging an das Körbchen, während ich mich abwandte und etwas vom Abendessen murmelte, damit sie mein Gesicht nicht sah.
In jener Nacht träumte ich wieder einmal von der Via dei Renai. Ich sah, wie sich die Läden scheinbar aus eigenem Antrieb öffneten und schlossen. Wie der Blumentopf umkippte und seine Erde über die Stufen ergoss. Ich sah, wie Mama vom Fenster aus auf mich herabblickte, eine Hand an die Scheibe gedrückt. Sie versuchte, mir etwas zu sagen. Ihre Lippen bildeten Worte, doch ich hörte sie nicht. Sie wurden übertönt vom Hall meiner Schritte auf dem Straßenpflaster.
Ich schreckte aus dem Schlaf und setzte mich auf. Schweiß rann mir vom Hals zwischen meine Brüste, dabei war es kalt im Zimmer. Dann merkte ich, dass Issa nicht in ihrem Bett lag. Als ich den Kopf hob, sah ich sie barfuß in der Tür stehen, den Kleinen in ihren Armen.
»Was ist? Was ist?«, fragte ich. »Was ist passiert?«
Ich nahm an, das Kind sei krank, es habe Fieber oder es hätte einen Bombenalarm gegeben.
Doch sie schüttelte den Kopf. »Nichts.«
Kalt und silbern strömte der Mondschein durchs Fenster herein.
Issa kam an mein Bett und setzte sich neben mich. Ihr Sohn starrte ihr ins Gesicht, und sie sah ihn an, wie ich es schon oft bei ihr erlebt hatte, sie musterte ihn ganz konzentriert, als würde sie in seinem kleinen Gesicht nach Carlo suchen – als könnte sie in den Kinderaugen, dem winzigen Mund, den runden Wangen jenen Teil von ihm wiederfinden, den sie in sich getragen hatte.
Ich beobachtete sie, beobachtete sie beide. Und als sie schließlich aufstand und ihn sanft in sein Körbchen legte, sah sie im kühlen Licht aus wie ein Phantom – sie sah aus, als würde sie langsam verblassen, sich mir unaufhaltsam entziehen.
»Er schläft jetzt«, sagte sie schließlich. Dann setzte sie sich wieder aufs Bett. »Ich muss mit dir reden.«
Ich schlug die Decke zurück, und sie legte sich hin. Ich spürte ihre Wärme, spürte ihr Herz an meinem schlagen, so wie früher in unseren Kindertagen. Aber dies hatte nichts Kindliches an sich. Es war, als wäre mein Traum durch die Dunkelheit zu ihr gereist.
»Denkst du manchmal daran?«, fragte sie. »An damals? An das, was damals passiert ist?«
»Ja«, sagte ich. »Ja, natürlich.«
»Ich auch. Ich kann es einfach nicht vergessen.«
»Du musst aber, Issa.« Ich wandte mich ihr zu. »Du musst es wenigstens versuchen.«
»Jemand wusste Bescheid.« Sie starrte an die Decke. Der Mond beschien ihre Wangen und ihre Nase, den Schwung ihrer Lippen und ihres Kinns. »Immer wieder gehe ich alles im Kopf durch«, sagte sie. »Alle, die dabei gewesen waren – wer es gewesen sein könnte. Ich rufe mir ins Gedächtnis, wie wir nacheinander eintrafen. Woher wir kamen. Wo wir am Vortag gewesen waren. In welcher Reihenfolge wir ankamen, und wo wir standen, als draußen der Lärm losging. Und warum. Warum könnte einer von uns das getan haben? Und wie?« Sie sah mir in die Augen. »Vor allem das verstehe ich nicht, wie? Wie? Wir kannten einander so gut. Wir waren eins.«
Der Kodex der GAP, dachte ich, die unerschütterliche Ehre und das absolute Vertrauen, auf das sie so fest gebaut hatte.
Ich hätte damals das Wort ergreifen können, hätte ihr erklären können, dass ich zu schnell gegangen war, dass ich es in meiner Zuversicht versäumt
Weitere Kostenlose Bücher