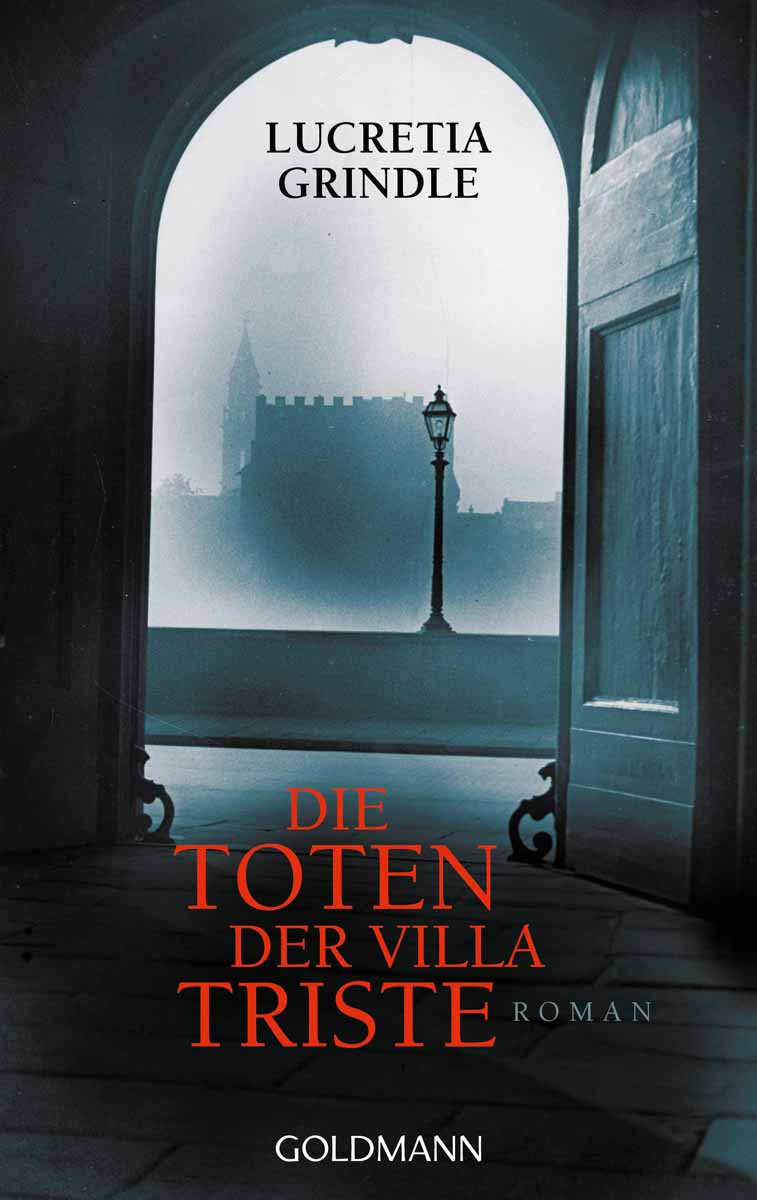![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
interessierte.«
»Und haben Sie ihn jemals gefragt, was das sein könnte?«
»Nein.«
»Und wie ist es zu Ihnen gekommen?« Pallioti nahm das kleine Buch wieder an sich, eigenartig erleichtert, den abgewetzten Einband wieder in der Hand zu spüren, so als hätte er es, indem er es offen auf den Tisch gelegt hatte, einer unbekannten Gefahr ausgesetzt.
»Soll ich nachschlagen, Papa?«
Severino wollte schon aufstehen. Der alte Herr winkte ab.
»Vom Roten Kreuz«, sagte er. »Sie versteigerten damals Fundsachen, Dinge, die ihnen anvertraut und nicht wieder abgeholt worden waren. Es steckte in einem gemischten Posten. Einem Karton, den ich erstanden hatte. Einem der letzten, Anfang der Siebzigerjahre.«
»Hier in der Stadt?«
»Ja.«
Pallioti nickte und stand auf.
»Ich danke Ihnen, Signor Cavicalli«, sagte er, »für Ihre Zeit.« Er überlegte kurz. »Darf ich Sie noch etwas fragen, wo ich schon einmal hier bin?«
Das blasse Gesicht sah zu ihm auf.
» Certo , Dottore. Wir stehen zu Ihrer Verfügung.«
»Il Spettro.«
»Ja.« Der Alte nickte.
»Die Geschichten sind ganz erstaunlich.«
Signor Cavicalli sagte nichts. Pallioti dachte an Eleanor Sachs, sah ihr kleines herzförmiges Gesicht vor sich, die gleichzeitig jungen und alten Züge.
»Glauben Sie, dass es ihn gegeben hat?«, fragte er.
Der Alte lächelte. »Die Menschen glauben so manches«, sagte er. »Aber das brauche ich Ihnen bestimmt nicht zu erklären.«
Signor Cavicalli streckte ihm die Hand hin. Pallioti ergriff sie. Die Finger zitterten.
»Eines allerdings«, er sah wieder zu Pallioti auf und lächelte, »finde ich wirklich erstaunlich. Ehrlich gesagt, Dottore, verblüfft es mich immer wieder.«
Pallioti spürte, dass Severino sie beobachtete. Unter dem hellen Licht wirkte das flaumige Haar wie ein weißer, schwebender Heiligenschein.
»Und das wäre?«, fragte Pallioti.
Der alte Herr schüttelte wieder den Kopf. »Dass selbst in der heutigen Zeit«, antwortete er, »die Menschen so wie zu allen anderen Zeiten grundsätzlich davon ausgehen, dass Helden Männer sind.«
25. Kapitel
Februar 1945
Ende November bekam ich einen weiteren Brief.
Als Kinder fuhren wir jedes Jahr nach Viareggio, und jedes Jahr hatte ich Angst, dass ich vergessen haben könnte, wie man schwimmt. Ich blieb am Strand stehen, schaute zu, wie Issa und Rico ans Wasser rannten und in die Wellen sprangen, und fürchtete gleichzeitig, ich könnte untergehen, falls ich ihnen folgte. Dass mich der kalte Schlag einer Welle treffen könnte und mein Körper mich nach dieser Ohrfeige im Stich lassen würde. Ich würde mit Armen und Beinen um mich schlagen, den Mund aufreißen und dann unter Wasser gezogen. Weggespült. Wie eine Muschel über den Meeresboden gerollt.
Genau so fühlte ich mich, als ich das dünne Blatt in Händen hielt und an Lodovico dachte, der immer noch lebte und jetzt in Neapel war – so, als wäre die Vergangenheit ein weites Meer, dem ich den Rücken zugewandt hatte. Ich wusste nicht, ob ich noch schwimmen konnte oder ob ich unter Wasser gezogen würde, wenn ich mich ihm wieder zuwandte.
Inzwischen wollte ich ihm gern antworten. Und ich glaubte, Lodovico anzulügen würde mir leichtfallen. Ich hatte das Gefühl, so oft gelogen und so viele Sünden begangen zu haben – ich hatte gestohlen und mich zur Hure gemacht –, dass es mir kein Kopfzerbrechen bereiten durfte, ihn anzulügen. Stattdessen merkte ich, als ich mich schließlich an den Tisch setzte und zum Füllfederhalter griff, dass die Wahrhaftigkeit zwischen uns der letzte winzige Schatz war, den ich mir bewahrt hatte und keinesfalls aufgeben wollte. Und so merkte ich, dass ich nicht wusste, was ich ihm schreiben sollte. Und wie ich es schreiben sollte. Zu guter Letzt beschränkte ich mich darauf, ihm zu erklären, dass wir außer Gefahr sind. Ich beschrieb ihm unsere Wohnung – die Piazza am oberen Ende der Straße. Das Rattern der Straßenbahn. Die Katze, die in der Wohnung gegenüber am offenen Fenster sitzt. Die Glocken der Kirche nebenan und das Hallen der Schritte im Treppenhaus.
Das alles schrieb ich ihm. Doch gleichzeitig wünschte sich etwas in meinem Herzen, ich könnte ihm zurufen: »Werde glücklich und suche dir eine andere. Weil ich nicht mehr die bin, für die du mich hältst. Geh. Weil du mich nicht mehr kennen kannst. Ich kenne mich selbst nicht mehr.«
Ich unterschrieb den Brief nicht – wir dürfen uns nicht verraten, falls er in falsche Hände gelangt. Stattdessen
Weitere Kostenlose Bücher