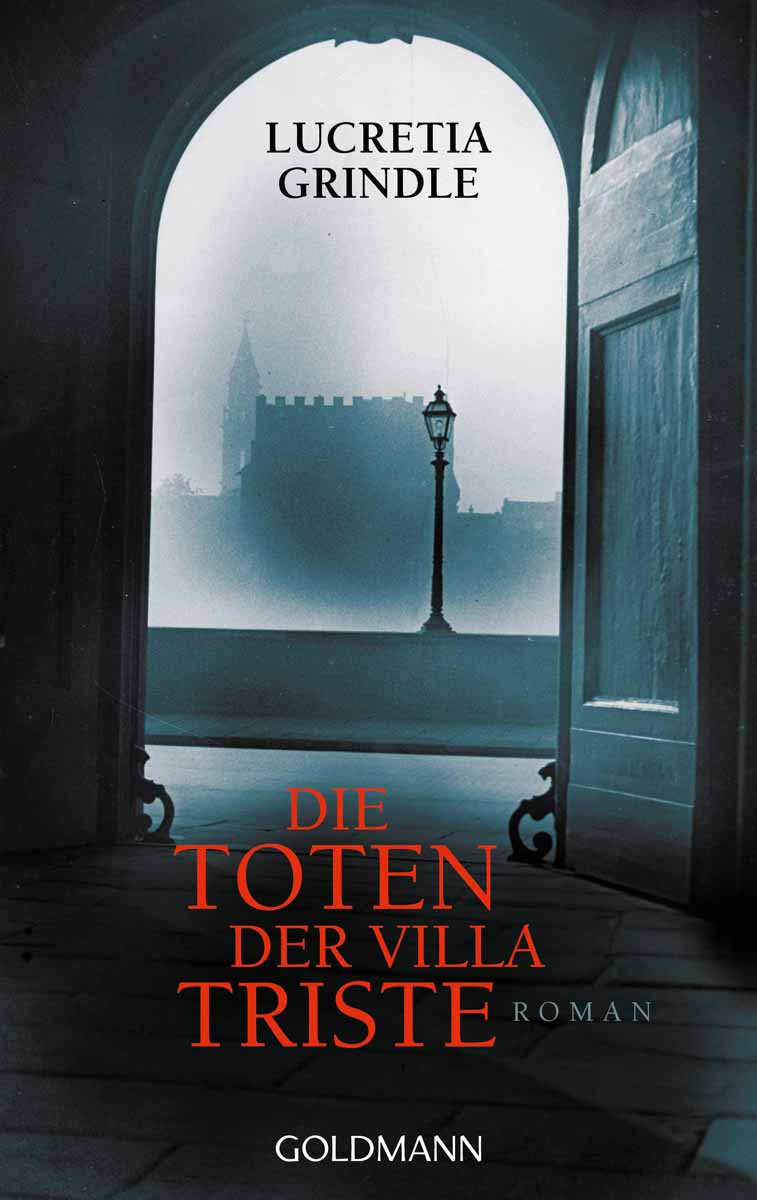![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
Valaccis Haut war blass und von feinen Falten durchzogen. In einem Augenwinkel pochte eine Ader. »Nicht oft genug«, sagte sie.
Dabei sah sie zum Kamin. Darüber blickte ein gemalter Mann im dunklen Anzug auf sie herunter, Antonios Uhren liebender Vater, wie Pallioti vermutete.
»Nicht oft genug. Mein ganzes Leben lang«, wiederholte Maria Valacci, »habe ich Giovanni nie oft genug gesehen.«
Sie verstummte. Pallioti machte sich auf einen weiteren Tränenschwall gefasst. Aber der blieb aus. Stattdessen kniff Maria Valacci die Augen zusammen und starrte ins Leere, so als wollte sie etwas – einen Augenblick, ein Wort, eine Geste – aus der Vergangenheit holen. Als ihr das nicht gelang, schüttelte sie den Kopf. Dann sagte sie: »Tonio hat recht. Giovanni interessierte sich nicht für uns.«
»Mama …«
»Nein. Es stimmt.«
Maria Valacci streckte die Hand nach ihrem Sohn aus. Eine Sekunde blieben die dünnen, fast klauenhaften Finger unerwartet zärtlich auf seinem Hinterkopf liegen. Dann zog sie die Hand zurück, schüttelte den Kopf und drehte dabei den schweren Saphirring an ihrer linken Hand.
»Vielleicht haben wir uns auch nicht für ihn interessiert«, sagte sie. »Jedenfalls nicht so, wie wir es hätten tun sollen. Um die Wahrheit zu sagen.«
Sie sah Pallioti an und lächelte. Es war nur der Hauch eines Lächelns, das Echo der jungen Frau, die sie früher gewesen war.
»Man hat es nicht leicht mit den Toten, finden Sie nicht auch, Ispettore?«, fragte sie unvermittelt. »Sie sind oft viel präsenter als die Lebenden. Vielleicht, weil sie überall zugleich sein können.« Ihre blassblauen Augen trübten sich kurz ein, dann rüttelte sie sich wach. »Auf jeden Fall«, ergänzte sie, »hielt mein früherer Mann nicht viel von Giovanni, auch wenn sich die beiden kaum je begegnet sind. Und eigentlich kannte auch ich meinen Bruder kaum, um ganz ehrlich zu sein. Nach dem Krieg habe ich ihn beinahe zwanzig Jahre nicht gesehen. Ich hielt ihn für tot. Eigentlich hätten wir genauso gut Fremde sein können. Was wir auch waren. Nehme ich an.« Sie sah auf ihre Hände. »Ich dachte, ich könnte das eines Tages wiedergutmachen, wie man sich das eben so vorstellt. Aber ich habe es nie geschafft. Ich war zehn Jahre jünger als Gio.«
Sie verstummte, und ihr Blick wanderte wieder in die Vergangenheit. Pallioti wartete ab.
»Mein Vater«, sagte Maria Valacci plötzlich. »Ich habe ihn geliebt. Er trug mich immer auf den Schultern und tat so, als wäre er ein Pferd.« Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Er starb im Krieg, mein Papa, in Russland. Er krepierte auf dem Rückzug, nachdem unsere deutschen Freunde beschlossen hatten, dass sie doch nicht mehr genug Truppen erübrigen konnten, um ihre geliebten Waffenbrüder zu retten. Mama, meine Mutter – sie hat ihm das nie verziehen. Sie kam nie darüber hinweg. Es machte sie krank. Sie war eine Gläubige gewesen, Sie verstehen?«
Die alte Frau sah Pallioti an und nickte dann. »Eine treue Gefolgsfrau des Duce «, sagte sie. »Eine Streiterin für den Stahlpakt. Diese Schande – sie kam einfach nicht darüber hinweg. Sie glaubte, mein Vater sei einfach zu feige und irgendwie selbst schuld gewesen. Dass er zurückgelassen wurde. Sterbend. Und sie damit im Stich ließ. Mussolini oder die Nazis konnte sie nicht hassen – darum hasste sie Papa. Und schließlich begann sie, auch Giovanni zu hassen. Sie hasste ihn, weil er ihr das angetan hatte.«
Pallioti beugte sich vor.
»Was angetan hatte?«
»Dass er sich den Partisanen anschloss. Das hat ihm Mutter nie verziehen. Obwohl er sich so um sie kümmerte. Er liebte sie, verstehen Sie?«, erklärte sie. »So, wie nur ein Kind seine Mutter lieben kann. So wie ein getretener Hund, der immer wieder angekrochen kommt. Sie starb in einem Sanatorium, unsere Mama. In der Schweiz, in der Nähe von Zürich. 1947.«
Sie verstummte so abrupt, wie sie begonnen hatte. Stille, getragen von einer Woge an Erinnerungen, breitete sich im Zimmer aus. Sie wurde vom Quietschen einer Tür und von den Schritten des Hausmädchens unterbrochen, das über das polierte Kastanienparkett getrippelt kam, in den Händen ein Tablett mit drei winzigen Porzellantassen und Untertassen.
Der Kaffee war bitter und stark und schien sie alle in die Gegenwart zurückzuholen. Weswegen, vermutete Pallioti, Antonio ihn in erster Linie angeboten hatte. Er fragte sich, wie viel Zeit Maria Valaccis Sohn wohl darauf verwandte, seine Mutter aus dem Strudel der
Weitere Kostenlose Bücher