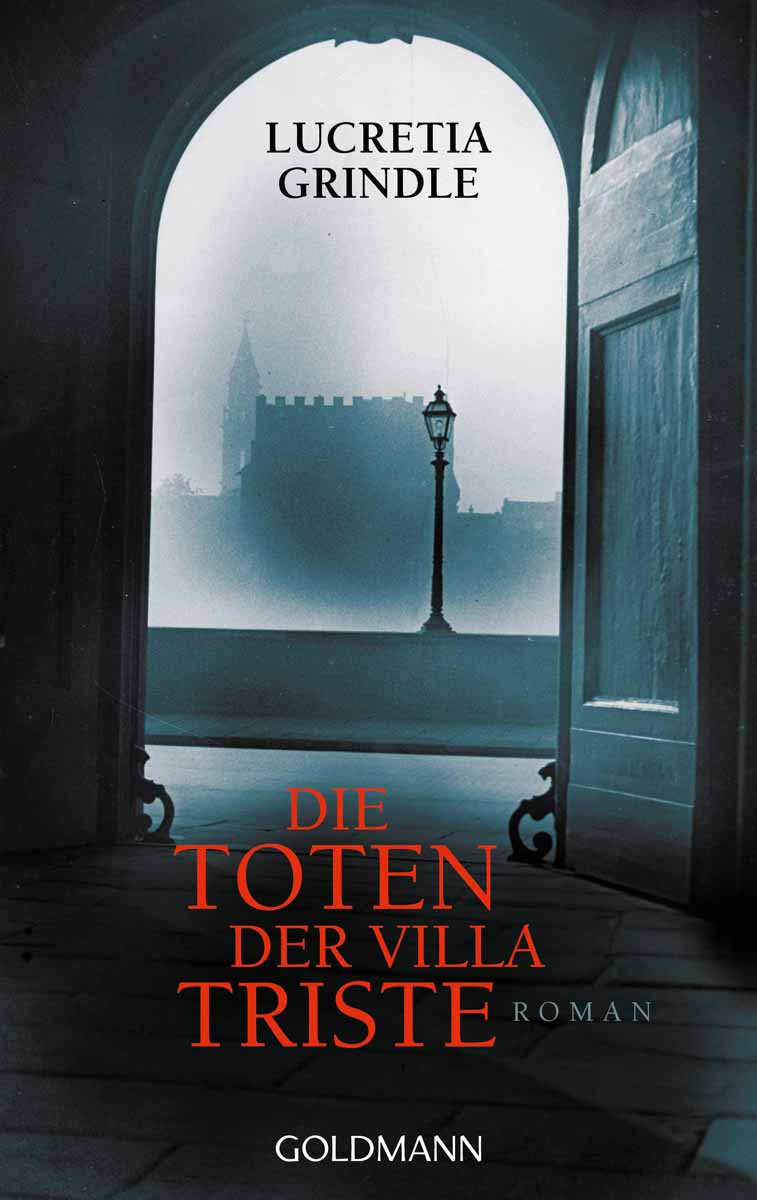![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
Arbeit, dieses Herumstochern im Leben anderer Leute. Doch wenn ich an Lodovico denke, weiß ich genau, dass ich mir wünschen würde – falls er irgendwo sterben sollte –, dass jemand seine Kleider zusammenpackt, sie mit seinem Namen beschriftet und sie für mich aufhebt.
Auf dem Weg zurück zu meinem Kämmerchen dachte ich darüber nach und fingerte in meiner Tasche nach dem Schlüssel. Doch als ich dort ankam, erkannte ich, dass ich den Schlüssel nicht brauchen würde. Die Klinke gab unter meiner Hand nach. Die Tür stand offen. Noch bevor ich sie aufzog, merkte ich, wie ich mich vor Ärger versteifte. Jemand war eingebrochen. Jemand hatte Vorräte gestohlen. Ich hörte etwas und stieß die Tür auf, überzeugt, dass ich den Dieb auf frischer Tat erwischen würde. Auf meiner Pritsche saß Isabella.
Wir starrten uns kurz an, dann war ich so froh, sie zu sehen, dass ich laut auflachte.
»Ich dachte, da würde jemand meine Vorräte stehlen«, sagte ich. »Ich dachte, du seist ein Dieb.«
Sie lächelte mich an.
»Bin ich auch.«
Wir hatten kaum zu zweit in der winzigen Kammer Platz. Issa hatte bereits meine Lampe angeschaltet. Hohe Schatten schossen die Wände hinauf, verloren sich in den Schachteln voller Mullbinden und Spritzen, bohrten sich in die Falten der Laken.
»Wie bist du hereingekommen?«, fragte ich.
Sie hob die Hände und schien sehr mit sich zufrieden. Wahrscheinlich hätte ich wissen sollen, dass mein wackliges Schloss sie nicht aufhalten konnte. Sie nickte zu dem Kleiderbündel hin.
»Was ist das?«
»Nichts.« Ich zuckte mit den Achseln. »Kleider. Von einem armen Kerl, den es bei Pontassieve erwischt hat.«
Sofort sprang Issa von der Pritsche auf und begann, ehe ich ihr Einhalt gebieten konnte, die Sachen zu durchwühlen und sämtliche Taschen zu durchsuchen.
»Was tust du da?«
Ich wollte ihr die Jacke wieder entreißen, aber sie ließ mich nicht. Eine Schulter war eingerissen, und die Brust war bis über den Ärmel mit Blut verkrustet, aber die Papiere des Toten hatten wie durch ein Wunder überlebt. Issa zog sie aus der zerschlissenen Lederbrieftasche und studierte sie unter der Lampe.
»Ist er tot?«
»Ja«, sagte ich. »Natürlich. Gib sie mir.«
»Die können wir brauchen.«
»Issa, nein!« Ich riss ihr das Dokument aus der Hand. »Er hat eine Familie!«, sagte ich. »Was würdest du sagen, wenn es Carlos Papiere wären?«
»Dass sie den Lebenden mehr nutzen als den Toten.«
Mit zitternden Händen schob ich die Papiere wieder in die Brieftasche.
»Also, das ist deine Entscheidung«, sagte ich. »Oder die von Carlo. Aber ich kann dir da nicht helfen. Das hier ist meine Arbeit. Und«, ergänzte ich fast zickig, »meine Pflicht.«
Ich glaubte, sie würde mir widersprechen, mich fragen, ob ich den Lebenden oder den Toten verpflichtet sei, womit sie mich durchaus in eine moralische Zwickmühle gebracht hätte, aber stattdessen ließ sie sich wieder auf die Pritsche sinken. Sie faltete die Beine unter sich ein wie eine Katze und sah zu, wie ich die Brieftasche in meine Schublade steckte, den Schlüssel abzog und ihn dann auf das Band um meinen Hals fädelte. Sobald ich ihn weggesteckt hatte, klopfte Issa auf die Pritsche. Ich setzte mich neben sie. Ich roch die vertraute Wärme ihres Pullovers und den leichten Lavendelduft von Seife. Eine Stunde lang war der Krieg vergessen, während wir in meiner winzigen Kammer saßen, über Rico und meine Eltern redeten und kurz auch über Carlo. Und dann, aus irgendeinem Grund, über unseren alten Hund, der letztes Jahr gestorben ist und unter meinem gelben Rosenstrauch begraben liegt.
Schließlich versiegten die Worte. So spät am Abend war es still im Krankenhaus. Gelegentlich waren Schritte zu hören, oder eine Tür quietschte. Wir kuschelten uns auf der Pritsche aneinander. Wie Vögel in einem Nest, dachte ich, die sich an einem sicheren Fleck zusammenkauern. Ich spürte, wie mir die Augen zufielen. Ich glaube, ich war beinahe eingeschlafen, als Issa sagte: »Cati, es gibt da noch etwas, das wir tun müssen.«
Sie sagte das ganz leise, beinahe flüsternd, außerdem gab es in Issas Welt immer etwas zu tun. Doch diesmal klang sie anders als sonst. Irgendwie wusste ich, dass sie nicht über zwei weitere abgeschossene alliierte Flieger redete. Widerwillig öffnete ich die Augen. Ich blickte sie an und sah in ihr ernstes Gesicht.
»Eine Familie«, sagte sie.
»Eine Familie?«
Sie nickte.
»Wie viele?«, fragte ich, weil ich die andere
Weitere Kostenlose Bücher