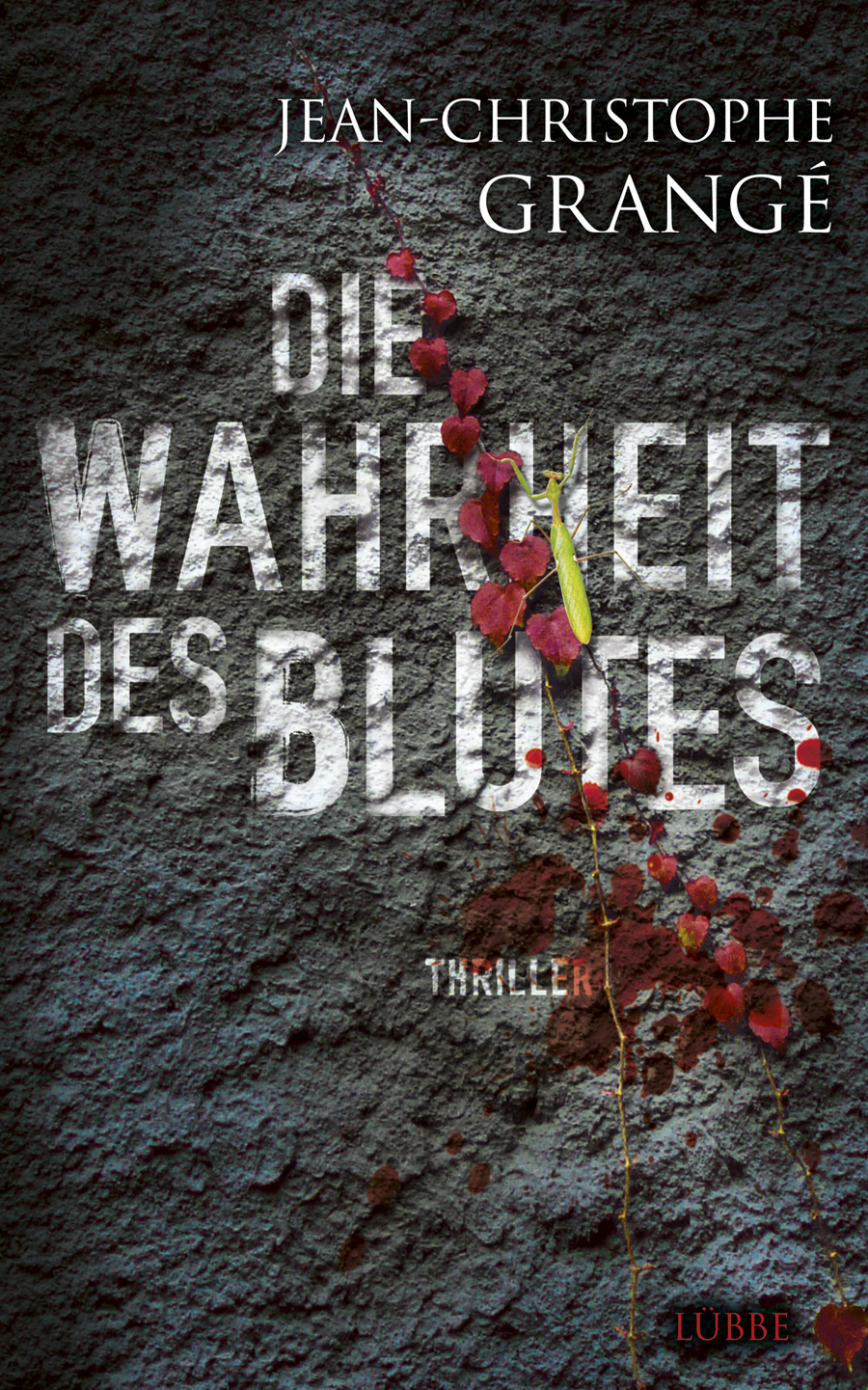![Die Wahrheit des Blutes]()
Die Wahrheit des Blutes
verprügelt. In Japan hingegen ging man schlicht davon aus, dass eine Ohrfeige manchmal Wunder wirkt. Naokos Vater, ein berühmter Geschichtsprofessor in Tokio, war das lebende Beispiel für diese These.
Zum Albtraum des häuslichen Lebens kam derjenige der Schule. Man erwartete von Naoko nicht nur, dass sie Jahrgangsbeste im Gymnasium war; sie musste sich auch gleichzeitig auf die Aufnahme in die Universität vorbereiten – zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun hatten. Neben dem täglichen Lernen für die Schule belegte Naoko Abend-, Wochenend- und Ferienkurse. Jedes Vierteljahr erfolgte die landesweite Einstufung. Dann erfuhr sie, dass sie auf Platz 3220 der Liste stand und somit für bestimmte Universitäten gar nicht erst infrage kam, was nicht gerade einen Motivationsschub bedeutete.
Aber Naoko ließ sich nicht entmutigen. Sie arbeitete wie ein Pferd, ohne sich je einen Tag Ferien oder auch nur eine Stunde Freizeit zu gönnen. Immerhin hatte sie sich obendrein auch noch mit Kampfkunst, Kalligrafie, klassischem Tanz und häuslichen Arbeiten in der Schule zu beschäftigen. Außerdem musste sie Kanji lernen, die alten, aus China stammenden Schriftzeichen, die mehrere Bedeutungen besitzen und jeweils unterschiedlich ausgesprochen werden.
Naoko perfektionierte sich mit eiserner Selbstdisziplin – sowohl geistig als auch körperlich.
Gleichzeitig – und das ist eines der Paradoxa Japans – wurde Naoko von ihrer Mutter geradezu verhätschelt. Bis zum Alter von acht Jahren schlief sie mit ihr zusammen. Noch mit fünfzehn weigerte sie sich, eine Nacht außerhalb des Elternhauses zu verbringen, und mit achtzehn hätte sie keine Entscheidung ohne die Zustimmung von mama-san getroffen.
Nach dem Abschluss in einem protestantischen Privatgymnasium in Yokohama schrieb sich Naoko an einer guten Universität in der gleichen Stadt ein. Sie war so viele Jahre täglich von Tokio nach Yokohama gefahren, dass es ihr vorkam, als hätte sie diese Reise längst im Blut – ein genetischer Fingerabdruck, den ihre Kinder eines Tages erben würden und in dem die Namen der Bahnhöfe die Chromosomen ersetzten.
Ihr Notendurchschnitt reichte nicht für ein Medizinstudium, aber Naoko war eigensinnig genug, um Jura abzulehnen – eine Fachrichtung, die ihr Vater befürwortet hätte. Stattdessen entschied sie sich für eine mehrgleisige Ausbildung: Ökonomie, Sprachen und Kunstgeschichte.
Im Jahr 1995 nahm ihr Leben eine ungeahnte Wende. Ein Fotograf sprach sie in der U-Bahn an und wollte Testfotos von ihr machen. Naoko konnte es kaum fassen. Sie war zwanzig Jahre alt, aber noch nie hatte jemand ihre Schönheit erwähnt. Japanische Eltern wären nicht im Traum auf die Idee gekommen, ihrem Kind Komplimente wegen seines Aussehens zu machen. Naoko war wirklich schön. Und nach dem ersten Shooting bekam sie es jeden Tag aufs Neue bestätigt. Bereits bei den ersten Castings verbuchte sie Erfolge und verdiente plötzlich Summen, die ihr unermesslich vorkamen. Trotzdem sagte sie ihren Eltern nichts, sondern widmete sich weiter ihrem Studium. Das Geld legte sie heimlich beiseite. Mit dem Ersparten wollte sie eines Tages dem strengen Vater entkommen. Fliehen, und zwar für immer.
Schnell begriff sie, dass ihre Karriereaussichten als Model im Ausland besser waren, denn ihr Äußeres entsprach nicht den japanischen Kriterien. Den Japanern gefielen Eurasierinnen ohne Lidfalte – Mädchen, die zwar aus dem Land der aufgehenden Sonne stammten, aber einen kleinen Hauch Exotik versprühten.
Mit dreiundzwanzig hatte Naoko ihre Abschlüsse in der Tasche und brach auf – zunächst nach Amerika, dann nach Europa. Sie arbeitete in Deutschland, Italien und Frankreich, wo man ihr perfektes Äußeres zu schätzen wusste. Mit ihrem glatten schwarzen Haar, den hohen Wangenknochen und der kurzen, ganz leicht gebogenen Nase stellte sie genau die Art Japanerin dar, von der Europäer träumten.
Was ihre Augen anging, so erklärte ein Mailänder Fotograf eines Tages, sie seien wie mit einem weichen Pinselschwung gemalt und trotzdem grausam und hart wie ein Messer.
Zwar verstand sie nicht ganz, was er damit meinte, aber es war ihr auch egal. Die Aufträge häuften sich, und der Rubel rollte. Aus rein beruflichen Gründen ließ sie sich schließlich in Paris nieder und verwirklichte dabei einen Lebenstraum – allerdings nicht ihren eigenen, sondern den ihrer Mutter. Oka-san war ihr Leben lang ausgesprochen frankophil gewesen, sah sich am liebsten
Weitere Kostenlose Bücher