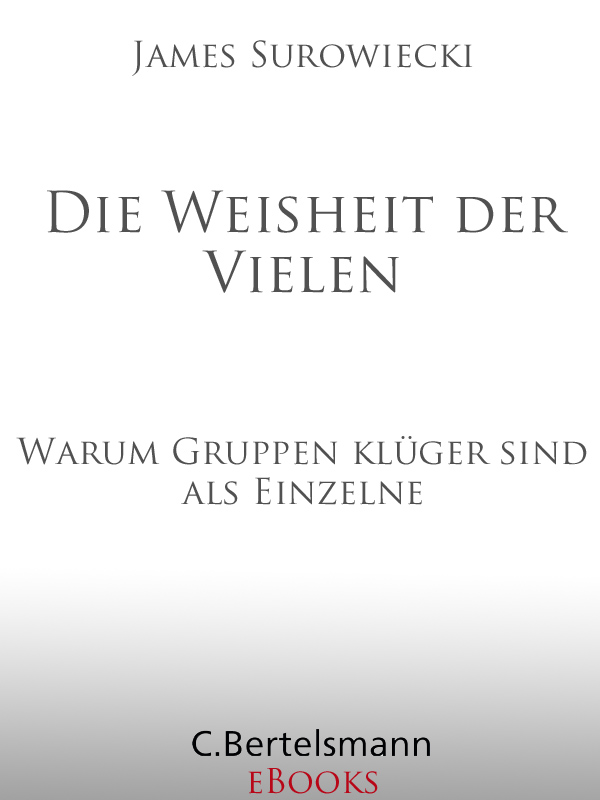![Die Weisheit der Vielen - Surowiecki, J: Weisheit der Vielen - The Wisdom of Crowds]()
Die Weisheit der Vielen - Surowiecki, J: Weisheit der Vielen - The Wisdom of Crowds
auf ein Eigentumsrecht zu verzichten – weil ihnen besser gedient wäre, wenn sie stattdessen als deren Entdecker anerkannt würden. Er hatte die Eigentümlichkeit von Wissen begriffen: Im Unterschied zu anderen Gütern wird es durch Nutzung nicht »verbraucht«; seine Verbreitung führt also nicht zu einem Wertverlust – im Gegenteil: Dadurch gewinnt es an Wert; je größer die Verbreitung, desto höher die potenzielle Valenz, weil sich das Spektrum möglicher Nutzanwendungen erweitert. Es war diese Einsicht, die, wie John Mokyr ausgeführt hat, den Grundstein der heutigen Wissenschaft legte. Mit ihr begann »die Freiheit der Wissenschaft, weil unser Wissen über die Natur auf die Weise zunehmend vom [bürgerlichen] Eigentumsbegriff gelöst wurde und wissenschaftlicher Fortschritt, statt geheimniskrämerisch auf einen kleinen Kreis von Eingeweihten beschränkt zu bleiben, wie es im Mittelalter üblich war, mit der Öffentlichkeit geteilt wurde. Auf diese Weise wurde die wissenschaftliche Erkenntnis zu einem öffentlichen Gut.«
Es war solch eine freie Verfügbarkeit, die den Erfolg der westlichen Wissenschaft begründete. Die offene Wissenschaft hat das individuell selbstsüchtige Verhalten der einzelnen Wissenschaftler kollektiv segensreich werden lassen. Die Wissenschaftler hatten ihre Bereitschaft bekundet, ihre Erkenntnisse publik zu machen, weil sie dadurch Anerkennung und öffentlichen Einfluss erlangten. Um es in Begriffen des Marktes zu umschreiben: Das Entgelt der Wissenschaftler besteht in ihrem Gewinn von Aufmerksamkeit. Der Wissenschaftssoziologe Robert K. Merton brachte dies auf einen berühmten Nenner: »In der Wissenschaft wird Privateigentum dadurch begründet, dass man seine Substanz weggibt.«
Heute lautet die Schicksalsfrage der westlichen Wissenschaft: Wird sie die wachsende Kommerzialisierung überstehen? Natürlich herrschen zwischen Naturwissenschaft und Kommerz seit Jahrhunderten enge Beziehungen. Doch die großen Unternehmen, die heute einen stetig wachsenden Anteil von Forschung und Entwicklung finanzieren, glauben Informationen aus wirtschaftlichen Interessen unter Verschluss halten zu müssen, statt sie in den freien Umlauf zu bringen, und das könnte die Wissenschaft elementar verändern. Traditionell ist Wissenschaft, um den Ökonomen Warren Hagstrom zu zitieren, keine Tausch-, sondern eine »Schenkwirtschaft«. Noch ist unter Wissenschaftlern und in der Öffentlichkeit die Vorstellung wirksam, dass die Wissenschaft essentiell aus »unsichtbaren Kollegien« besteht, die einander im gemeinsamen Interesse an Wissenserweiterung verbunden sind. Unternehmen sind jedoch generell weder Schenker, noch gedeihen sie auf der Basis von Kollegialität untereinander. Weil die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln für die Wissenschaft, insbesondere aber die Grundlagenforschung, ausschlaggebend ist, bleiben die Forscher in gewissem Maße vom kommerziellen Druck isoliert. Und wenngleich das Patentsystem die Nutzung einer Erfindung durch andere einschränkt, trägt es doch dazu bei, den freien Informationsfluss aufrechtzuerhalten. Ein Forscher kann für seine Erfindung ja nur dann ein Patent erlangen, wenn er die Details seiner Erfindung preisgibt. Der Konflikt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist jedoch unbestreitbar. Die Philosophie von Unternehmen, Forschungen zwar zu finanzieren, jedoch gleichzeitig zu verlangen, dass sie unterdrückt werden, wenn die Ergebnisse nicht ihren Vorstellungen und Wünschen entsprechen, würde Henry Oldenburg gar nicht gefallen haben.
Über wissenschaftliches Arbeiten im Sinne eines Strebens nach Anerkennung zu sprechen könnte den Eindruck erwecken, als seien Forscher ruhmsüchtige Wesen (was bei manchen natürlich der Fall ist). Anerkannt zu sein ist aber etwas völlig anderes, als eine »Berühmtheit« beziehungsweise ein »Modestar« zu sein. Es ist der Lohn für echte Leistungen und interessante Entdeckungen. Klar, dass solche Anerkennung von Wissenschaftlern auch aus rein menschlichen Gründen ersehnt wird – weil Reputation einfach gut tut. Sie möchten aber vor allem aus dem Grund anerkannt werden, weil neue Ideen nur über Anerkennung in den allgemeinen Wissensfundus aufgenommen werden. Das ist im Zusammenhang kollektiver Problemlösungen insofern eigenartig, als diese Anerkennung eine allgemeine ist: Es ist die Gemeinschaft der Wissenschaftler, die entscheidet, ob eine wissenschaftliche Hypothese wahr beziehungsweise neuartig ist oder nicht. Damit
Weitere Kostenlose Bücher