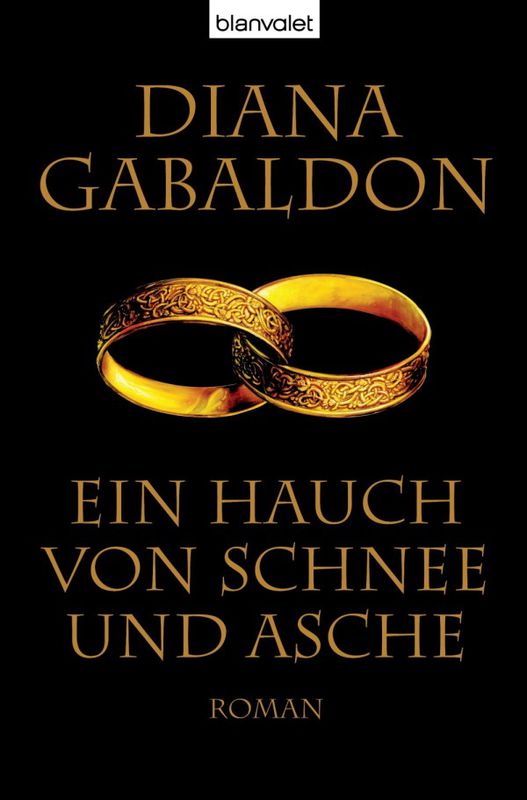![Ein Hauch von Schnee und Asche]()
Ein Hauch von Schnee und Asche
gehört, wie einer der jungen Männer etwas von einem Stelldichein bei Neumond gesagt hätte?«
»Ja«, sagte ich ein wenig argwöhnisch. Wir hatten dem Kapitän so wenig wie möglich erzählt, da wir nicht wussten, ob er womöglich irgendwie mit Bonnet in Verbindung stand. »Das ist morgen Nacht, oder?«
»Das stimmt«, pflichtete er mir bei. »Aber was ich sagen will, ist – wenn man ›Neumond‹ sagt, meint man wahrscheinlich auch die Nacht, aye?« Er blickte in den leeren Flaschenhals, dann hob er die Flasche und blies nachdenklich darüber hinweg, so dass ein tiefes Wuuuug ertönte.
Ich verstand den Wink mit dem Zaunpfahl und reichte ihm eine andere.
»Dank’ Euch sehr, Ma’am«, sagte er mit glücklicher Miene. »Nun, um diese Zeit im Monat ist die Gezeitenwende gegen halb elf – und dann setzt die Ebbe ein«, fügte er viel sagend hinzu.
Ich sah ihn verständnislos an.
»Nun, wenn Ihr genau hinseht, Ma’am, seht Ihr, dass jetzt halb Ebbe ist« – er wies nach Süden -, »aber dicht am Ufer hat das Wasser eine mittlere Tiefe. Doch wenn es Nacht wird, wird das nicht mehr so sein.«
»Ja?« Ich wusste immer noch nicht, worauf er hinauswollte, aber er war geduldig.
»Nun, bei Ebbe ist es natürlich einfacher, die Sandbänke und Buchten zu sehen – und kommt man auf einem Schiff mit einem flachen Kiel, sollte man diesen Zeitpunkt wählen. Aber wenn ein Stelldichein mit etwas Größerem geplant ist, das vielleicht mehr als eins zwanzig Tiefgang hat – nun, dann -« Er trank einen Schluck und wies mit dem Boden seiner Flasche auf eine weit entfernte Stelle am Ufer. »Dort ist das Wasser tief, Ma’am – seht Ihr die Farbe? Wären wir ein großes Schiff, wäre das bei Ebbe der beste Ankerplatz.«
Ich betrachtete die Stelle, auf die er gezeigt hatte. Das Wasser war dort deutlich dunkler, ein dunkleres Blaugrau als die Wellen ringsum.
»Das hättet Ihr uns auch früher sagen können«, sagte ich mit tadelndem Unterton.
»Das stimmt, Ma’am«, pflichtete er mir freundschaftlich bei, »aber ich wusste ja nicht, ob Ihr es hören wolltet.« Dann stand er auf und spazierte zum Achterschiff, eine leere Flasche in der Hand, auf der er geistesabwesend »Wuug-wuug-wuug« blies wie ein Nebelhorn in der Ferne.
Als die Sonne ins Meer sank, erschienen Roger und Ian am Ufer, und Moses, Kapitän Roarkes Helfer, ruderte ans Ufer, um sie abzuholen. Dann setzten wir die Segel und segelten langsam am Strand von Ocracoke entlang, bis wir Jamie fanden, der uns von einer winzigen Landspitze aus zuwinkte.
Nachdem wir ein Stück vom Ufer entfernt für die Nacht vor Anker gegangen waren, tauschten wir unsere Notizen aus – so wir denn etwas zu berichten hatten. Die Männer waren ausgelaugt; erschöpft von ihrer Suche in der Hitze, hatten sie trotz der körperlichen Anstrengung wenig Appetit. Roger wirkte besonders angespannt und blass und sagte fast gar nichts.
Der letzte Rest des Sichelmondes erhob sich am Himmel. Wortkarg nahmen die Männer ihre Decken und legten sich an Deck nieder. Innerhalb von Minuten waren sie eingeschlafen.
Obwohl ich reichlich Bier getrunken hatte, war ich hellwach. Ich saß neben Jamie, hatte mir zum Schutz vor der Kühle des Nachtwindes die Decke um die Schultern gelegt und beobachtete die flache, rätselhafte Insel. Die Ankerstelle, die Kapitän Roarke mir gezeigt hatte, lag unsichtbar in der Dunkelheit. Würden wir es merken, fragte ich mich, wenn morgen Nacht ein Schiff kam?
Es kam sogar schon in dieser Nacht. Ich erwachte ganz früh am Morgen, weil ich von Leichen träumte. Mit hämmerndem Herzen setzte ich mich auf und sah Roarke und Moses an der Reling stehen. Es hing ein schrecklicher Geruch in der Luft. Es war ein Geruch, den man nie vergaß, und als ich aufstand und an die Reling trat, um festzustellen, was los war, überraschte es mich überhaupt nicht, dass Roarke »Sklavenschiff« murmelte, während er kopfnickend nach Süden wies.
Das Schiff lag etwa eine halbe Meile entfernt vor Anker, seine Masten schwarz vor dem heller werdenden Himmel. Kein riesiges Schiff, aber eindeutig zu groß, um die kleinen Kanäle der Insel zu befahren. Ich beobachtete es lange Zeit, und als Jamie, Roger und Ian aufwachten, schlossen sie sich an – doch es senkten sich keine Boote herab.
»Was meint Ihr, was es hier macht?«, sagte Ian. Er sprach leise; das Sklavenschiff machte alle nervös.
Roarke schüttelte den Kopf; ihm gefiel das Ganze auch nicht.
»Soll mich der Teufel holen, wenn
Weitere Kostenlose Bücher