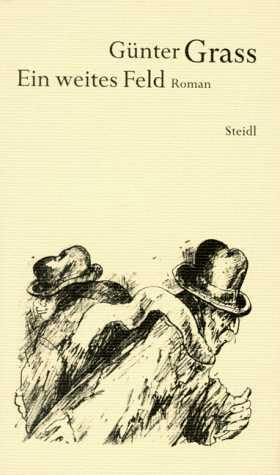![Ein weites Feld]()
Ein weites Feld
leid getan, wie er so schluckte und sein Adamsapfel immer rauf runter. ›Mußt gar nich viel sagen, Wuttke‹, hab ich gesagt. ›Da is was nachgekommen von früher, stimmt’s?‹
Und schon hat er bißchen gelächelt und dann drauflos geredet, wie er so redet immer, Sie kennen ihn ja. Erst von dem jungen Ding, na, dem Enkelkind, dann gleich vom Krieg und was in Lyon damals los war, einfach schrecklich alles. Und warum er das rote Dingsda an der Jacke hat nu, nein. nich wegen Kommunismus, sondern für echte Verdienste. ›Aber glaub bloß nicht, daß ich ein Held war!‹ hat er gerufen. Und dann hat ihm natürlich sein Einundalles wieder mal in die Suppe gespuckt, weil ihn nämlich diese Marlen -sein Enkelkind nennt sich och so – an ne gewisse Romanfigur, nämlich an diese Lene Nimptsch, erinnert hat. Und daß die Vorgeschichte von dieser Lene bis nach Dresden und in die damalige Revolution zurücklangt, wo sie Freiheitslieder gesungen und auf der Elbe gerudert haben. Doch als mein Wuttke nur noch von anno dazumal und rein gar nix mehr von seiner Kriegsbraut erzählen gewollt hat, da hab ich gesagt: ›Laß man gut sein, Wuttke. Ob inner Revolution oder im Krieg, da passiert vieles so nebenbei, was man nich gewollt hat. Hättste mir ruhig früher flüstern können, ich schluck sowas. Hab schon viel schlucken gemußt. Ob aber unsre Martha … oder wenn ich an Friedel denk, der so moralisch is … oder Teddy mit seiner Beamtenkarriere … Ich werd damit fertig. Und vielleicht is es besser so, wenn es erst jetzt rauskommt. Aber kennenlernen will ich die schon, die Marlen, dein Enkelkind, hab dich nich so …‹«
Emmi konnte kein Ende finden; und für uns war das von Interesse. Anfangs haben wir mehr aus Jux oder Gewohnheit, später mit Absicht gesammelt. Zu Zeiten der Arbeiter-und Bauern-Macht hatte uns das Archivwesen einen gewissen Halt gegeben, nun aber, seit Wegfall des Staates, wurden uns dessen Bestände fragwürdig. Mehr und mehr rutschten wir in Fontys Geschichte. Er war uns lebendiger als das in Karteikästen gezwängte Original. Nicht nur ihm, seiner Familie gaben wir uns gefangen. Und Emmi war froh, daß sie sich so offen aussprechen konnte. Seitdem ich bei Marthas Hochzeit den Trauzeugen abgegeben hatte, vertraute sie uns und besonders mir. Wer, außer uns, hätte ihr so geduldig zuhören wollen? In einer Zeit schnellen Wechsels waren wir, wenn nicht Teil der Familie Wuttke, dann doch deren Ohr und Ablage; selbst Nichtigkeiten haben wir aufgehoben, zum Beispiel, daß Emmi im Boot, als immer häufiger von Madeleine die Rede war, plötzlich »Wie einst, Lili Marlen!« gesungen hat, bestimmt, um Fonty, der schon wieder alles ganz leicht nahm, ein wenig zu ärgern. Jedenfalls kam es zwei Tage später, am Nachmittag des 2. Oktober, zu einer familiären Kahnfahrt. Fonty hatte als Theo Wuttke eingeladen. Anfangs ging es ein wenig steif zu. Madeleine ruderte und behielt dabei mit schnellen, prüfenden Augen das Paar auf der Heckbank im Blick. Mal fixierte sie ihren Großvater, mal dessen Frau. Und wenn sie sich, sobald sie die Ruder durchgezogen hatte, leicht zurücklehnte, sah sie beide zugleich: Fonty verlegen gerührt, mit Neigung zu Triefaugen, dabei stocksteif, als hätte er, aller Widerrede zum Trotz, den berüchtigten preußischen Ladestock verschluckt; Emmi unbekümmert um ihre Fettleibigkeit, mit der sie weit mehr als die Hälfte der Bank belegte. Dabei war sie gar nicht verlegen, eher zeigte sie sich als Herrin der Situation. Er an den Rand gedrückt, sie überbordend, er wie ertappt, aber mit Haltung, sie ganz Ausdruck bedrohlicher Gutmütigkeit. Ein Bild, gerahmt als Ikone alles überdauernder Bürgerlichkeit: Herr und Frau Wuttke. Und Mademoiselle Madeleine? Ihren schnellen Augen müssen wir nun einen leichten Silberblick nachsagen, der sich immer dann zum Schielen steigerte, wenn sie zum nächsten Ruderschlag ansetzte und sich vorbeugen mußte, bis ihr das sitzende Paar zu nah kam und so ihre sonst auf klare Sicht geschulten Augen verwirrte. Viel sprach man anfangs nicht. So beladen der Kahn war, es fehlte die mittlere Generation; ausgespart blieben Fragen, die Fonty nicht zu stellen wagte, denn hätte er um Auskunft über das Befinden von Cécile Aubron, geborene Blondin, gebeten -»Und wie geht es deiner Mama, mein Kind?« –, wäre sein nachgetragenes Interesse allenfalls höflich nichtssagend bedient worden. Madeleine hätte von der sozialpädagogischen Tätigkeit ihrer Mutter in einem von
Weitere Kostenlose Bücher