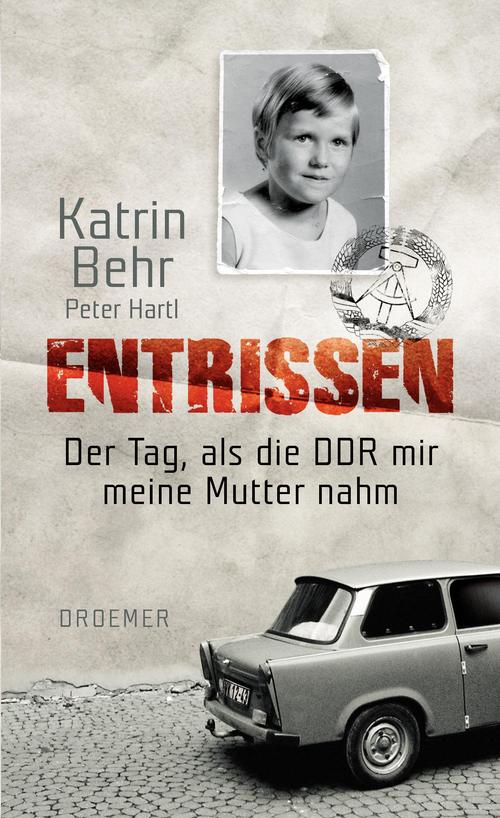![Entrissen]()
Entrissen
können. Wenn Vati nachmittags von der Arbeit kam, kümmerte er sich aufmerksam um sein Söhnchen. Gemeinsam unternahmen wir dann Ausflüge in unser kleines Wäldchen, und Papa erklärte uns wie so oft, was da so alles kreuchte, fleuchte und blühte. Als Junge vom Land kannte er sich in der Natur bestens aus.
Ich fühlte mich durch meinen Bruder nicht an den Rand gedrängt. Nie hatte ich den Eindruck, dass ich Sören gegenüber zu kurz kam. Im Elternhaus genoss der Sohn keine Vorzugsbehandlung, denn er wurde nicht weniger streng erzogen als ich. Die ungeschriebenen Regeln, an die ich mich zu halten hatte, galten, altersgemäß angepasst, auch für ihn. Sobald er in der Lage war, einen Teller unfallfrei festzuhalten, bekam auch er das Geschirrtuch in die Hand gedrückt. Ich fand wenig Anlass, ihn um seine Position zu beneiden. Sein einziges Privileg war, dass er klein war und daher anfangs noch kaum gefordert.
Anders verhielt es sich, wenn Mutti mit uns beiden gemeinsam in der Stadt unterwegs war. Da verwandelte sich das oft wenig beachtete Bübchen in ihren Kronprinzen. Sie strich ihm allenthalben übers Haar, pries seine Lernfortschritte, wenn sie ein Schwätzchen hielt, und konnte sich ausdauernd darüber auslassen, in welcher Hinsicht der Sohn nach den Eltern geraten sei. Bisweilen kam mir der kleine Sören wie eine Trophäe vor, die sie vor sich hertrug. Ich existierte in solchen Momenten kaum noch.
Sobald sich die Haustür hinter uns schloss, war es damit für gewöhnlich jedoch wieder vorbei. Dann erhielt ich meistens wieder die Verantwortung für mein Brüderchen. Dabei ließ Mutti nie einen Zweifel aufkommen, wie sehr sie ihren Sohn liebte. Am meisten aber genoss es Sören, wenn er zusammen mit seiner großen Schwester am Wochenende hin und wieder im Gästezimmer unter dem Dach nächtigen durfte. Am nächsten Morgen konnte es dann tatsächlich geschehen, dass Mutti uns mit einem Frühstückstablett am Bett überraschte. Wegen mir allein hätte sie sich diese Mühe wohl nicht gemacht, dennoch ließ ich mir das ungewohnte Verwöhnprogramm am Morgen gerne gefallen.
Die Werteskala meiner Adoptivmutter war nach anderen Prioritäten justiert. Sie sah sich stets zuallererst in der Pflicht ihrer Republik, der sie ihren Aufstieg zu verdanken hatte. Ihr Geltungsbedürfnis befriedigte sie bevorzugt mit ihrem gesellschaftlichen Dasein. Ihre öffentlichen Auftritte, die vielen Ansprachen, Appelle und Versammlungen, schienen ihre gesamte Kraft und Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Sie lebte für ihren Beruf, und die Partei war ihre wahre Familie. Nirgendwo sonst fand sie so viel Bestätigung und Zuwendung, keine andere Tätigkeit hatte ähnlich große Bedeutung für sie. Als Genossin verkörperte sie die gleichberechtigte berufstätige Frau, wie sie der Sozialismus als Idealbild propagierte. Auch dank meiner Hilfe.
Irgendwann im Laufe des Jahres 1979 war ich mit meiner Geduld am Ende. Vielleicht war es eine Begleiterscheinung der Vorpubertät. Mit meinen zwölf Jahren wollte ich mir jedenfalls nicht mehr alles bieten lassen und war nicht mehr bereit, klaglos hinzunehmen, dass meine Meinung nicht gefragt war. Immer häufiger kam es vor, dass ich meiner Mutti widersprach.
Ich wurde zunehmend aufsässig. Wenn mir ein Auftrag nicht passte oder ich stattdessen lieber in meine Bücherwelt entfliehen wollte, beschwerte ich mich, statt die Aufgabe wie früher schweigend zu erledigen. Das nützte zwar nichts, denn meine Mutti war stets stärker und die Drohung mit Fernsehentzug zog noch immer, aber es tat gut, ihre Autorität überhaupt angefochten zu haben. Ich fühlte mich ein Stück weit weniger ausgeliefert.
So wagte ich es schließlich gegen Ende des Jahres 1979 , die Frage zu stellen, die in einer Endlosschleife durch meinen Kopf kreiste, seit ich zurückdenken konnte. Die Frage, die so nahelag und mir dennoch bislang unaussprechlich erschienen war. Gelegenheit dazu fand sich unverhofft eines Abends, als Mutti mich ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit zum Einkaufen begleitete, ohne dass wir Sören im Schlepptau hatten. Es war schon dunkel, als wir das Haus verließen, und trotz blauem Anorak und Wollmütze kroch die feuchte Kälte dieser trüben Jahreszeit in mir hoch. Die Bäume am Straßenrand, die ihre Blätter schon weitgehend in die Winterpause geschickt hatten, erschienen mir wie trostlose Wegbegleiter. In der Dunkelheit wirkten die bröckelnden Fassaden der Langenberger Einkaufsstraße noch grauer als sonst.
Weitere Kostenlose Bücher