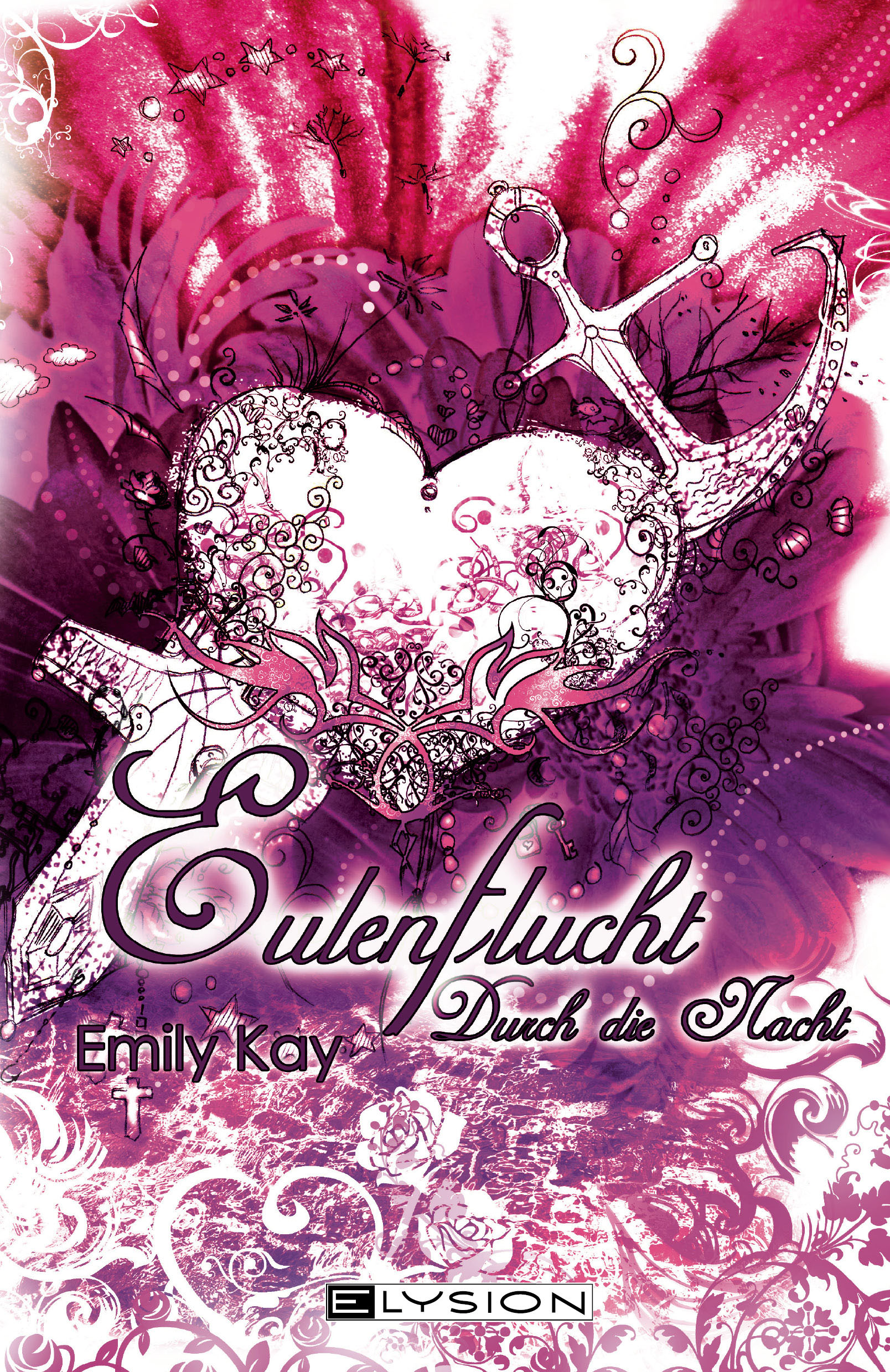![Eulenflucht - Kay, E: Eulenflucht]()
Eulenflucht - Kay, E: Eulenflucht
nickte tapfer, mit einem Kloß in der Kehle, und brachte sogar ein halbes Lächeln zustande. Mein Vater ging auf die Wand zu und setzte sich auf eine alte Holzkiste, die unter dem Kellerfenster stand. Ich legte mich auf die Säcke in der Ecke, rollte mich zusammen, umklammerte meinen Geigenkasten und starrte an die Wand. Mein Vater ahnte nichts von meinem Kummer, als sich meine Augen mit Tränen füllten und ich gegen meine Verzweiflung ankämpfte. Dieser Krieg machte alles kaputt! Der Gedanke daran, Samuel zu verlieren, krampfte meinen Brustkorb zusammen und nahm mir die Luft zum Atmen. Ich schluckte hart und bemühte mich, regelmäßig ein und aus zu atmen. Wenn ich nur wüsste, was er gerade dachte und wie es ihm nach dieser Nacht erging? Ich konnte Dresden nicht verlassen. Ich musste ihn sehen, musste Gewissheit bekommen, ob er überlebt hatte. Bei dem Gedanken, dass er umgekommen sein könnte, wurde mir heiß und kalt. Ich zitterte am ganzen Leib. Nein, diesen Gedanken durfte ich nicht haben, schalt ich mich. Samuel lebte. Ich würde ihn am nächsten Tag treffen, und vielleicht könnte ich ihn überzeugen, sich unserem Flüchtlingstreck anzuschließen, beruhigte ich mich. Eine Trennung von ihm kam nicht in Frage.
Ich wartete und tat, als würde ich schlafen. Erst nachdem ich sicher war, dass alle schliefen, sah ich auf. Mein Blick fiel auf meinen Vater. Seine Schultern hingen herab, und das Kinn lag auf seiner Brust. Er schlief, immer noch auf der Holzkiste sitzend. Mir blieb nicht viel Zeit, ich musste mich beeilen. Ich wollte hier raus. Nein, ich musste hier raus, um zu sehen, ob das Lyzeumnoch stand. Dort traf ich mich nahezu täglich mit Samuel, Doktor Drachenberg, meinem Lehrer, und vier weiteren Kameraden, obwohl der reguläre Schulunterricht längst zum Erliegen gekommen war. Bei dem erneuten Gedanken, Samuel könnte etwas passiert sein, zog sich mein Magen zusammen, und eine leichte Übelkeit überkam mich. Ich musste hier unbedingt hinaus! Vorsichtig blickte ich mich um und lauschte auf die regelmäßigen Atemzüge der Schlafenden. Sollte ich es wagen, mich über den Willen meiner Eltern hinwegzusetzen? Sollte ich das Risiko eingehen, in einen Tieffliegerangriff zu geraten? Ich wollte meine Eltern nicht verlassen, aber vor allem musste ich wissen, wie es Samuel ging. Die Ungewissheit wurde immer unerträglicher, und mein Herz fühlte sich wie ein Nadelkissen an, in dem feine Nadeln steckten. Ich musste mich entscheiden. Ich schloss kurz die Augen und atmete tief durch. Eines war sicher. Ich würde ganz auf mich allein gestellt sein. Vorsichtig erhob ich mich, griff nach meinem Geigenkasten, stieg leise über die Schlafenden hinweg und schlich zu der Holztür. Ich zog meinen Schal enger um den Hals und blickte noch einmal zurück auf meine schlafenden Eltern und meine kleine Schwester die ruhig und vertrauensvoll in den Armen meiner Mutter lag.
Mit einem wehmütigen Gefühl wandte ich mich wieder der grünen Kellertür zu, hielt angespannt die Luft an und drückte langsam und vorsichtig die Klinke nach unten, damit bloß kein verdächtiges Geräusch mein Vorhaben zunichte machte. Die Tür ließ sich geräuschlos öffnen, und ich trat aus dem Keller in den muffigen Flur. Leise schlich ich die Treppenstufen nach oben und tastete mich in der Dunkelheit bis zu der Haustür vor.
Es kostete einige Kraft, die schwere Holztür zu öffnen. Dann blickte ich in einen trüben Februarmorgen. Kein Geräusch war zu hören. Über der Straße hing der Rauch der Brände. Er verdunkelte den Himmel. In der Luft lag ein beißender, verbrannter Geruch, der beim Einatmen einen säuerlichen Nachgeschmack auf meiner Zunge verursachte. Ruinen umgaben mich und ich bemerkte erschüttert, dass ich vor dem einzigen heilen Haus in unserer Straße stand. Ich erschauderte und entschied, nicht weiter darüber nachzudenken, da mich sonst der Mut verlassen hätte, den Weg bis zum Lyzeum zu gehen. Die Umgebung erschienunwirklich und gleichzeitig bedrohlich.
Samuel!
Wenn er tatsächlich tot wäre, würde ich es spüren. Ich musste ihn finden!
Wider meiner Furcht ging ich mit schnellen Schritten los, bemühte mich darum, die gespenstische Kulisse zu missachten. Die Straße war menschenleer und ausgestorben. In der Ferne stiegen immer noch schwarze Rauchschwaden auf. Auf den Pflastersteinen lag der Schutt der Ruinen. Sie waren von einer schwarzen, rußigen Schicht überzog und Glassplitter von zerbrochenen Fensterscheiben lagen auf der
Weitere Kostenlose Bücher