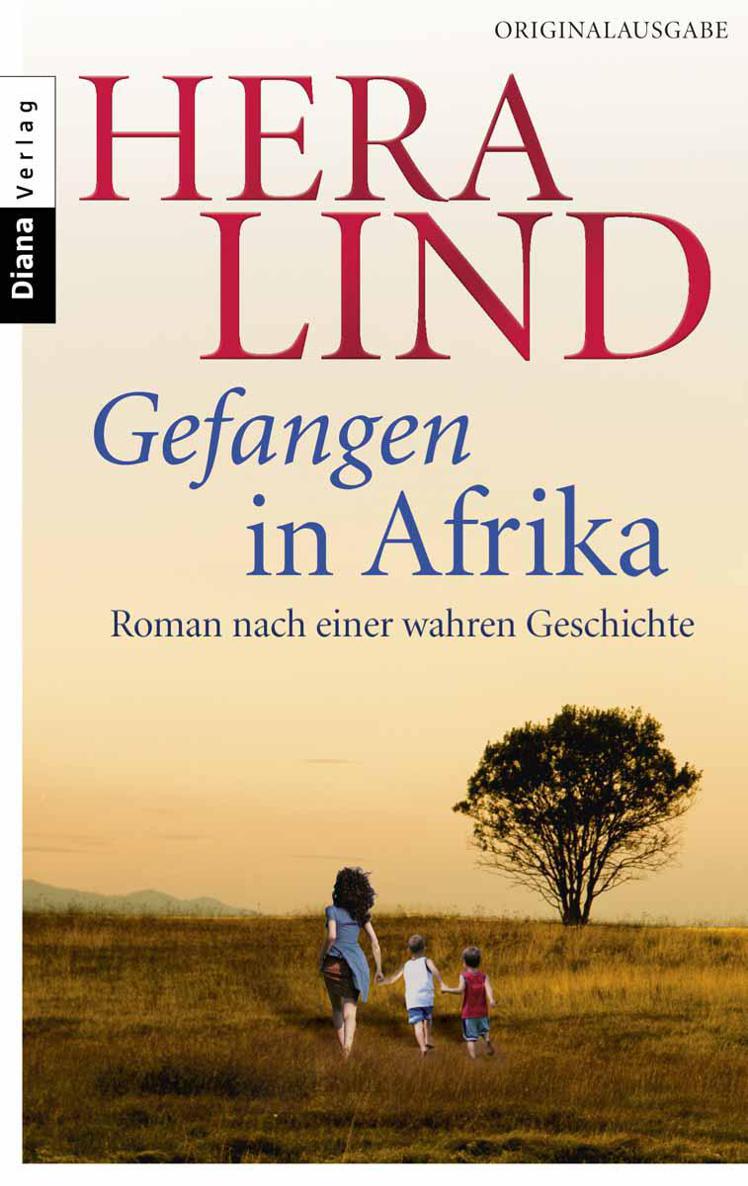![Gefangen in Afrika: Roman nach einer wahren Geschichte (German Edition)]()
Gefangen in Afrika: Roman nach einer wahren Geschichte (German Edition)
stiefelte ich neben ihm über den schummrigen Gang.
»Was praktisch ein Leichtes wäre«, sagte Jürgen Bruns grinsend. »Aber das würde ich natürlich nie wagen.«
Die Nachtschwester saß in ihrem Glaskasten und beugte sich über ein Kreuzworträtsel. Sie schien uns gar nicht zu bemerken. Ein Hauch von Verbotenem, eine Spur von nächtlichem Abenteuer kribbelte in meinem Bauch. Vielleicht wollte sie auch nichts merken. Sie gönnte uns Patienten unsere Bekanntschaften, und vielleicht gönnte sie mir nun auch diesen kleinen Flirt.
»Aber nun haben Sie noch gar nichts von sich erzählt«, flüsterte ich fast schuldbewusst, als wir vor Jürgen Bruns’ Türe stehen blieben.
»Dazu haben wir ja noch alle Zeit der Welt«, gab er zurück. Er streifte meinen Arm. »Gute Nacht, kleine Wolfsfrau.«
Mit diesen Worten verschwand er in seinem Zimmer.
Ich schlich nach nebenan in meines. Vor dem Spiegel über dem Waschbecken blieb ich stehen und betrachtete mich mit den Augen, mit denen er mich sehen musste. Ich war regelrecht ausgemergelt. Nie im Leben würde er etwas an mir finden. Kopfschüttelnd ging ich ins Bett.
Dort legte ich das Ohr an die Wand und lauschte. Schlief er schon? Las er noch? War er in Gedanken noch bei mir? Oder suchte er gerade nach Möglichkeiten, mir in Zukunft aus dem Weg zu gehen? Er konnte einfach sagen, dass ihn mein Zigarettenqualm störe. Dass er ein anderes Zimmer wünsche. Dass er Ruhe brauche. Dabei wünschte ich mir nichts sehnlicher, ihm weiter aus meinem Leben erzählen zu dürfen.
4
Meine Schwester schlief lange Zeit allein in der kalten Abstellkammer unter der Stiege, in der auch sämtliche Vorräte aufbewahrt wurden. Erst als ich fünf Jahre alt war, durfte ich meinen Strohsack im Gitterbett verlassen und mit ihr die schmale Pritsche teilen. Wir zerrten an der dünnen Wolldecke, die nicht mal für eine von uns reichte. Trotzdem fühlte ich mich bei ihr geborgen. In den Regalen standen Dörrobst und die Gläser mit dem Eingemachten, die Johannisbeer- und Stachelbeermarmelade von unseren Sträuchern im Vorgarten, die ohne Zucker eingekocht wurde, denn Zucker war nach dem Krieg Mangelware. Daher war die Marmelade immer von einer pelzigen Schimmelschicht bedeckt, aber wir aßen sie trotzdem. Die wenigen Dosen mit Dörrfleisch, die meine Mutter dort hortete, waren für besondere Anlässe wie den Besuch des Pfarrers oder der Krankenschwester reserviert. Auch der selbst gekelterte Most in ein paar klebrigen Flaschen, auf denen stets Fliegen herumkrabbelten, blieb seltenen Festen vorbehalten. Nie im Leben hätten wir gewagt, davon zu naschen. Wir Kinder bekamen einmal in der Woche ein Glas Saft, und zwar sonntagmorgens vor der Kirche. Wahrscheinlich hoffte meine Mutter, dass wir davon kurzfristig rote Wangen und ein gesundes Aussehen bekommen würden.
In der Vorratskammer roch es modrig, und vor dem vergitterten Fenster sah man Wolkenfetzen und ein paar Fichtenzweige, die sich im Winde bogen. Ab sechs Uhr morgens knatterten draußen Lastwagen vorbei, die Sand und Dreck aufwirbelten und unser Häuschen in eine gelbliche Staubwolke hüllten, von der wir husten mussten. Auf dem Hinweg waren die Lastwagen leer, heulten aber im zweiten Gang bergauf. Auf dem Rückweg waren sie mit Felsbrocken und Geröll beladen.
Meine Schwester musste mich vor der Schule in den Kindergarten bringen, schließlich war ich vier Jahre jünger als sie. Schon die Siebenjährige zerrte mich Dreijährige bereits am frühen Morgen über den dunklen Waldweg in Richtung Dorf. Die Mutter wollte mich aus dem Weg haben, und wenn wir nicht um halb sieben aus dem Haus waren, prügelte sie uns hinaus. Der Kindergarten war evangelisch, die Schule meiner Schwester hingegen streng katholisch. Dort wurde sie jeden Morgen von der Lehrerin vor dem Rest der Klasse verprügelt: Weil sie mich in einen gottlosen Kindergarten gebracht hatte. Da mussten Zeichen gesetzt werden. Wenn das jeder machen wollte, wären wir bald ein Volk von Heiden. Und so hatte meine Schwester jeden Morgen die Wahl: Entweder die Mutter zog ihr eines mit dem Schürhaken über, wenn sie sich weigerte, mich lästigen Klotz am Bein mitzunehmen. Oder aber die Lehrerin gab ihr zehn Schläge mit dem Lineal auf die offene Hand. Die Klasse musste laut mitzählen. Verachtung für die asozialen Heiden aus der Steinbruchsiedlung schwang in so mancher Schülerstimme mit. Schließlich kamen viele reiche Bauernkinder noch aus der Nazischmiede: hart wie Kruppstahl, dumm wie
Weitere Kostenlose Bücher