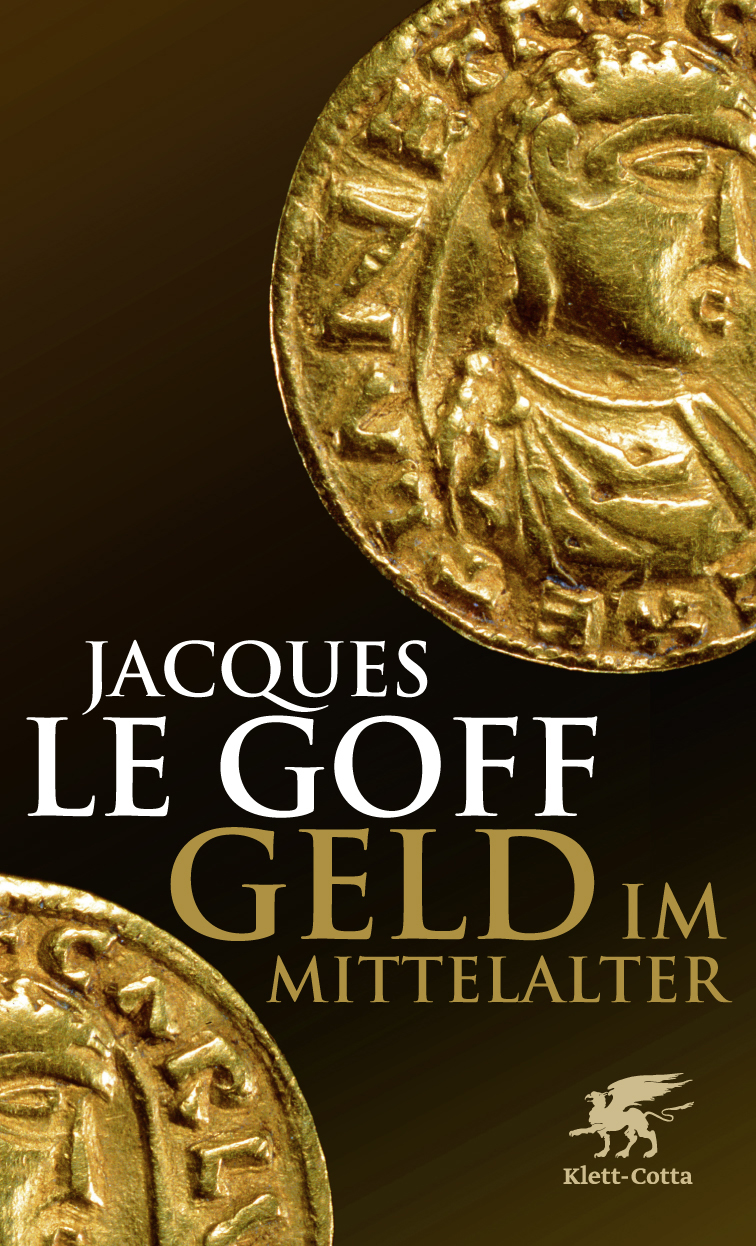![Geld im Mittelalter]()
Geld im Mittelalter
frühen Vorläufer dieser Praxis 996 in Utrecht, wo die Kirche einen Ritter zum Vasallen machte, allerdings nicht durch Überlassen von Land, sondern durch Aussetzen einer Rente von 12 Pfund Denaren, die jährlich auszuzahlen war. Das Rentenlehen erfuhr eine schnelle Entwicklung in den Niederlanden, vor allem seit dem Ende des 12. Jahrhunderts.
Die Grundlage dieses Wachstums des Geldumlaufs bildete die Ökonomie, das heißt hauptsächlich der Handelsverkehr, doch vermutlich das meiste Geld kostete im Mittelalter eine Aktivität, die fast pausenlos erfolgte: der Krieg. Inzwischen ist zwar nachgewiesen worden, dass der Krieg sparsamer mit Menschen umgegangen ist, als man früher glaubte, denn gerade die zunehmende Bedeutung von Geld machte es profitabler, einen Feind gefangenzunehmen und Lösegeld zu fordern, statt ihn zu töten – man denke an das Lösegeld, das für Richard Löwenherz bei seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land gezahlt wurde, oder das für Ludwig den Heiligen, um ihn aus der muslimischen Gefangenschaft in Ägypten freizukaufen, beide Male waren es sehr hohe Geldsummen –, indes bedeuteten die Vorbereitung und Ausrüstung eines Heeres gigantische Ausgaben. Der englische König Johann Ohneland, der selbst nicht an der Schlacht bei Bouvines (1214) teilnahm, zahlte dennoch für das Heer seiner Verbündeten 40000 Mark Silber. In einem anderen Buch habe ich darauf verwiesen – und Georges Duby hat dies eindrucksvoll belegt –, dass die Turniere, jene großen ritterlichen Feste, die allen Verbotsbemühungen der Kirche getrotzt haben, in Wirklichkeit ein riesiger Markt waren, vergleichbar mit dem der heutigen Sportgroßveranstaltungen, wo Geld eine wichtige Rolle spielt. Ein weiterer Grund für erhöhte Ausgaben war das Aufkommen von Gepränge, hauptsächlich an den Königs- und Fürstenhöfen und bei wohlhabenden städtischen Bürgern. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts veranlassten die rasch steigenden Ausgaben für Luxuswaren und Pomp (ausgefallene Gewürze und Speisen, aufwendige Garderoben, insbesondere Seide und Pelze, vor allem für Frauen, Gagen für Troubadoure, Minnesänger, fahrende Sänger) einige Könige, Fürsten und Kommunen, Luxusgesetze zu erlassen, um den Exzessen Einhalt zu gebieten. Im Jahr 1294 erließ Philipp der Schöne eine Ordonnanz »betreffend die Überflüssigkeiten in der Garderobe«, die besonders an die Adresse der Stadtbürger gerichtet war. Hiernach war den Bürgern und Bürgerinnen das Tragen von Pelzwaren, Goldschmuck, Edelsteinen, Gold- oder Silberkronen sowie Kleidern, die einen Wert von 2000 Tournois bei Herren und 1600 bei Damen überstiegen, nicht mehr gestattet. In der Toskana des 14. Jahrhunderts verboten die Statuten der Städte den zur Schau gestellten Prunk auf Hochzeiten, etwa bei Kleidung, Geschenken, Gastmahlen und Hochzeitszügen, auf das Strengste. 30 Und 1368 verbot Karl V. von Frankreich die berühmten Schnabelschuhe, allem Anschein nach jedoch ohne großen Erfolg.
Bezeichnenderweise befindet sich in der Kathedrale von Amiens, die im 13. Jahrhundert errichtet wurde, ein kleines Standbild mit der Darstellung zweier Kaufleute, die mit Färberwaid zu Wohlstand gekommen waren, jener Färberpflanze, die im 13. Jahrhundert aufgrund der wachsenden Nachfrage nach blauen Kleidern eine ungeheure Nachfrage erfuhr. So wurden Mode und Luxus und das damit verdiente Geld an einem geweihten Ort ausgestellt!
6
Das Geld und die Entstehung der Staaten
Z u den wichtigsten Phänomenen, in denen sich während der Glanzzeit des langen 13. Jahrhunderts das Aufblühen der Geldwirtschaft am deutlichsten zeigt, gehört die Entstehung eines Gebildes, das die Geschichtsschreibung gemeinhin Staat nennt. Dieser Staat hatte im 13. und 14. Jahrhundert den Feudalismus noch nicht ganz abgestreift (bekanntermaßen war dieser Prozess erst mit der Französischen Revolution abgeschlossen). Gleichwohl markierten die monarchische Herrschaft, die Entstehung repräsentativer Institutionen und die Weiterentwicklung von Recht und Verwaltung eine entscheidende Etappe auf dem Weg zu seiner Entstehung. Der Staat wurde in einem Bereich besonders sichtbar, in dem das Geld im 13. Jahrhundert eine wichtige Bedeutung annahm: der Fiskalpolitik. Neben den Lehnsabgaben kamen den Fürsten und Königen generell die Erträge aus eigenem Landbesitz, die Gewinne aus dem Münzregal (sie besaßen die Münzhoheit) und die Erhebung von Sondersteuern zugute.
Finanzverwaltung
Der früheste, beherrschende und mit
Weitere Kostenlose Bücher