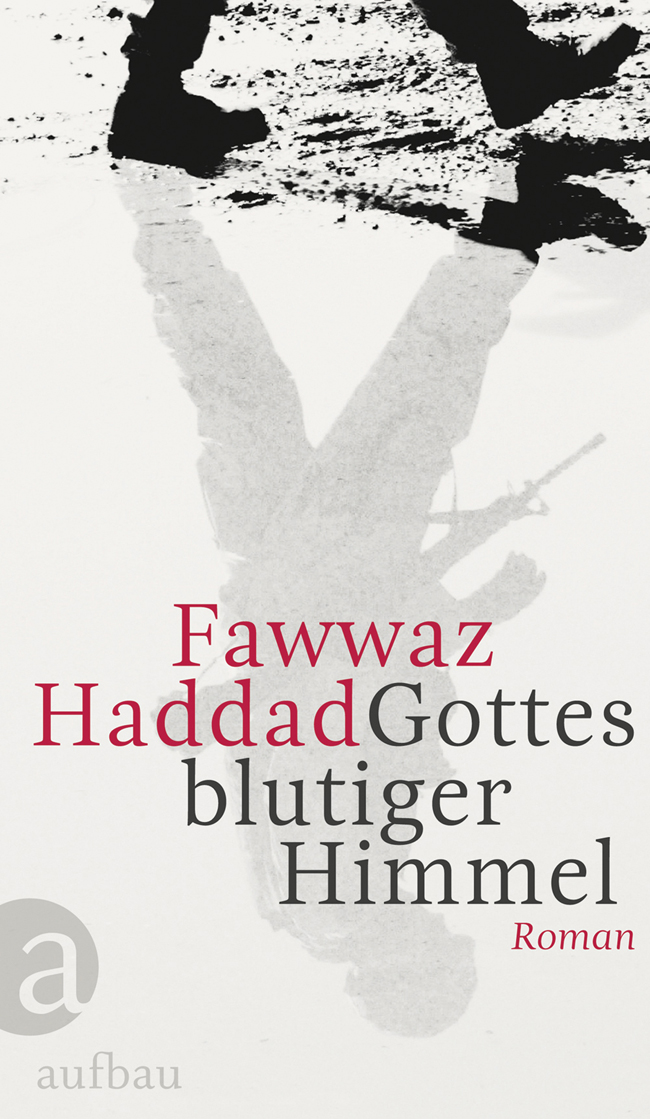![Gottes blutiger Himmel]()
Gottes blutiger Himmel
az-Zarqawi, »und er weiß, dass es auch dir gut geht. Du wirst ihn morgen sehen. Anschließend wirst du einige Tage als sein Gast verbringen.«
Er erklärte mir, dass Samer kein Selbstmordkandidat sei, sondern eine Führungsperson. Ich atmete auf, das hieß, dass ich noch Zeit hatte. Auch er schien sich nun zu entspannen. Er goss Tee in ein Glas, reichte es mir und sagte: »Wir nennen ihn Abdallah, Diener Gottes. Er hat sich den Namen selbst gewählt. Aber weil wir alle Gott dienen, haben ihm die Brüder noch den Beinamen as-Suri gegeben. Er heißt also jetzt Abdallah der Syrer.«
Ich dankte ihm für meine Rettung, aber er schien sich nicht für das Thema zu interessieren, so als hätte er nichts dergleichen angeordnet. Er sagte nur: »Vielleicht haben wir das Richtige getan.«
Ich sagte: »Es hätte gereicht, dass Sie meine Entführer bestrafen. Sie hätten sie nicht töten müssen.«
Aber er lächelte nur verächtlich und sagte: »Die haben ihre Strafe bekommen.«
»Gott allein gibt und nimmt das Leben«, theologisierte ich, »keinem Geschöpf steht es zu, jemanden in den Tod zu schicken.« Ich wollte klarstellen, was ich von ihm hielt, damit er nicht dächte, ich würde seine Taten gutheißen, und sei es nur, um meine eigene Haut zu retten. Aber az-Zarqawi sagte energisch: »Die ganze Scharia ist nur dazu da, Gutes zu befördern und Übel abzuwenden. Das Abwenden eines Übels ist Voraussetzung dafür, Gutes herbeizuführen.«
»Schlechtes wendet man nicht nur durch Töten ab«, wandte ich ein.
Er schien sich selbst zu befragen, was er nun antworten müsse. Aber mir war bewusst, dass dies hier kein Mann war, der lange überlegte. Die Maske der Nachdenklichkeit, die er trug, und die Bedachtheit, die aus seinen Gesten zu sprechen schien, konnten mich nicht darüber hinwegtäuschen, zu welcher Grausamkeit er fähig war.
»Nur durch Töten«, beharrte er. »Wir sind im Krieg.«
Ich wollte ihm meine Sicht auf den Krieg, den er führte, darlegen: »Mit dem Töten darf man es nicht übertreiben. Jemandem die Kehle durchzuschneiden ist eine schreckliche, unentschuldbare Tat.«
»Geben Sie mir Panzer und Flugzeuge, dann brauche ich niemandem die Kehle durchzuschneiden«, gab er zurück und führte aus: »Was die Amerikaner heute erleben, ist nichts im Vergleich zu der Demütigung, die uns zuteilwurde. Seit Jahrzehnten metzeln sie uns in Palästina, in Tschetschenien und in Kaschmir hin. Hast du nicht gesehen, was sie hier im Irak anrichten?«
Es war unsinnig, mit ihm darüber zu diskutieren, dassseine menschlichen Bomben keinen einzigen Luftangriff, dem Dutzende, Hunderte oder Tausende Unschuldiger zum Opfer fielen, verhinderten.
»Man sollte dem Menschen nichts aufbürden, was er nicht zu tragen imstande ist«, sagte ich.
»Dies ist eine Prüfung für uns alle«, meinte er.
»Die Amerikaner haben Sie in den Irak gelockt, um Sie hier zu vernichten!«
»Unsinn, wir haben sie hierhergelockt, und jetzt lassen wir sie ausbluten. Dies ist ein weltweiter Krieg, der noch lange nicht zu Ende ist. Sie wollten ihn, aber wir auch. Es ist eine gottgegebene Gelegenheit, eine Schlacht gegen den großen Satan zu führen. Und so viele Opfer wir bringen, so viel werden wir gewinnen.«
Mich ärgerte sein selbstgefälliger Ton. Er tat, als käme er aus einer anderen Welt, einer Welt von Ritterlichkeit, Tapferkeit und Opferbereitschaft. Mit Schwertern wollte er gegen Interkontinentalraketen, Atombomben, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge kämpfen.
»Diesen Krieg werden Sie schwerlich gewinnen.«
»Wir sind Leute des Glaubens, und wir stellen unser Schicksal Gott anheim.«
Er bemerkte meine Fassungslosigkeit und fuhr fort: »Wir werden sie im Irak besiegen, danach werden wir weiterziehen, um Syrien, Jordanien und Äg ypten von den Tyrannen zu befreien. Und schließlich werden wir mit Gottes Hilfe Jerusalem erobern.«
Ich sah ihn an und merkte, dass er weiterreden wollte und dass ich mich weiterärgern würde.
»Seien Sie nicht zu optimistisch«, sagte ich.
Er erwiderte nichts. Er wollte keinen Streit mit mir. Ich war sein Gast, er war mein Gastgeber und mein Retter. In Wahrheit war ich sein Gefangener, aber er verbiss es sich,Unmut zu zeigen. Seine Nervenstärke beeindruckte mich mehr als seine ausgeprägten Muskeln. Ich war nicht überrascht, als er kurz darauf dazu überging, mich zu provozieren. Barsch sagte er: »Spar dir das Treffen mit Abdallah.«
»Wenn Sie wüssten, was ich durchgemacht habe und welche unsäglichen
Weitere Kostenlose Bücher