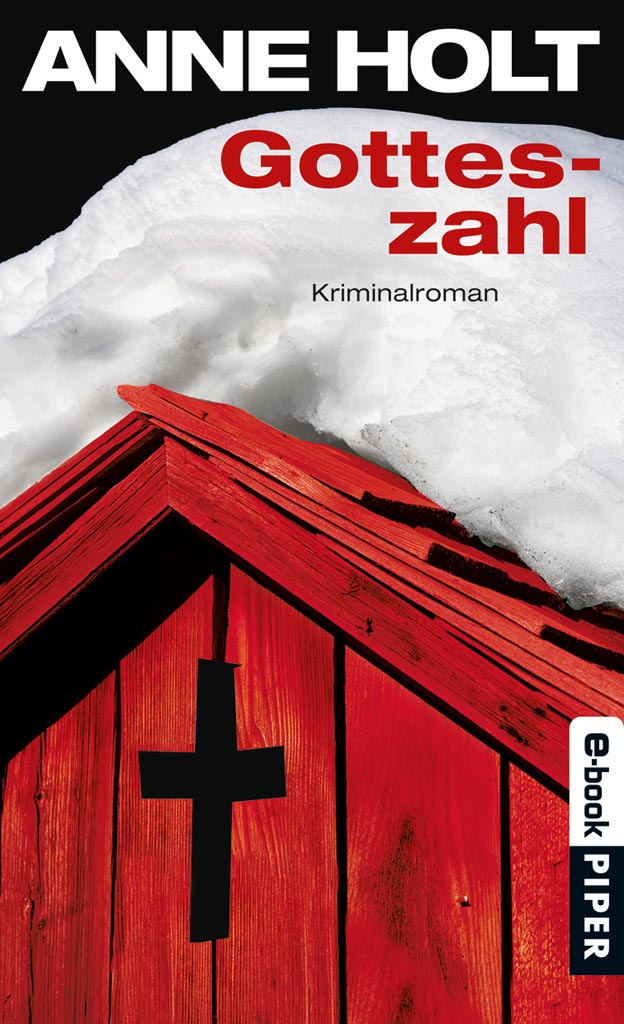![Gotteszahl]()
Gotteszahl
einmal in der Handschrift des Vaters geschrieben waren. Er wurde zu einem erwachsenen Mann, als er das Geld wieder in den Umschlag steckte und zurückgehen ließ.
Die Verbindung restlos zu kappen war überraschend einfach. Sie sahen einander so selten, dass man den zwei oder drei Besuchen im Jahr leicht entgehen konnte. Gefühlsmäßig hatte er sich längst für einen anderen Vater entschieden: Marcus Koll sr. Und als er diesen Entschluss gefasst hatte, war er erleichtert. Befreit. Zu etwas Besserem.
Das Erbe wollte er nicht haben.
Es war ziemlich groß.
Georg Koll hatte in den Sechziger- und Siebzigerjahren mit Immobilien viel Geld gemacht. Lange genug vor dem Immobiliencrash während der letzten Finanzkrise des zwanzigsten Jahrhunderts hatte er den Großteil seines Vermögens in andere und sicherere Bereiche verlagert. Das Talent, das ihm als Vater und Versorger fehlte, hatte er auf dem Gebiet der Geldvermehrung. Seine Yuppiezeit hatte er genutzt, um seine Investitionen zu sichern, statt sie für mögliche kurzfristige Gewinne aufs Spiel zu setzen.
Bei seinem Tod hinterließ Georg Koll eine mittelgroße Kreuzfahrtreederei, sechs überaus solide Mietshäuser in der Innenstadt, dazu ein klug zusammengesetztes Aktienportfolio, das in den letzten fünf Jahren für den Großteil seines respektablen Einkommens gesorgt hatte. Der Tod hatte ihn offenbar überrascht; er war erst achtundfünfzig gewesen, schlank und durchtrainiert, als ein Herzschlag ihn eines Tages Ende August auf dem Weg aus dem Büro zu Boden warf. Da er nicht wieder geheiratet hatte und sich auch kein Testament auftun ließ, fiel sein Vermögen Marcus Koll, dessen Schwester Anine und dem kleinen Bruder Mathias zu.
Aber Marcus wollte nichts davon wissen.
Mit fünfzehn hatte er den Judaslohn des Vaters zurückgeschickt, mit zwanzig hatte er eine Antwort erhalten. Einen Brief. Dem Vater war zu Ohren gekommen, dass sein ältester Sohn homosexuell war. Marcus hatte den Brief überflogen und schnell begriffen, was sein Vater ihm sagen wollte. Dass er sich nachdrücklich vom Lebensstil seines Sohnes distanzierte, das war um 1984 keine seltene Einstellung. Schlimmer war, dass der Vater, der sich niemals an einen Gott gehalten hatte, trotzdem von Marcus’ Zukunft ein Bild zeichnete, das den schwärzesten Darstellungen von Sodom und Gomorrha entsprach.
Außerdem erinnerte er ihn an eine entsetzliche neue Seuche aus Amerika, die nur homosexuelle Männer traf. Man starb einen schmerzhaften Tod, mit Beulen und Eiter, wie bei der Schwarzen Pest. Georg Koll glaubte natürlich nicht, dass es sich dabei um eine Strafe der höheren Mächte handelte. Nein, hier griff die Natur selbst ein. Diese tödliche Krankheit war für ihn die Folge einer natürlichen Auslese; in zwei Generationen würden solche wie Marcus ausgerottet sein. Falls er sich nicht zusammenriss. Ein Leben als Homosexueller bedeutete ein Leben ohne Familie, ohne Sicherheit, ohne Bindungen und Verpflichtungen und ohne das Glück, das denen zuteil wurde, die gute Bürger und nützliche Menschen waren. Bis der Sohn dieses einsähe und garantieren könnte, dass er sich eines Besseren besonnen hätte, müsse er sich als enterbt betrachten.
Da der Pflichtteil, auf den leibliche Kinder einen Anspruch hatten, im Vergleich zu Georg Kolls gesamtem Vermögen belanglos war, lag hinter dieser Drohung eine Realität. Für Marcus spielte das keine Rolle. Er verbrannte den Brief und versuchte, die Sache zu vergessen. Und als fünfzehn Jahre später das Erbe zu verteilen war, stellte sich heraus, dass der Vater, offenbar im Glauben an seine eigene Unsterblichkeit, kein Testament gemacht hatte.
Marcus beharrte trotzig auf seinem Standpunkt: Das Geld des Vaters wollte er nicht.
Erst als der Großvater, der ansonsten seinen ältesten Sohn Georg nie erwähnte, Marcus jr. davon überzeugte, dass nur er das Familienvermögen sinnvoll verwalten könne, kam er ins Schwanken. Der Bruder war Lehrer, die Schwester arbeitete in einer Buchhandlung. Marcus war Betriebswirt, und da beide Geschwister darauf bestanden, mit den gesammelten Werten aus dem Nachlass des Vaters eine neue Firma zu gründen, die allen gemeinsam gehören und die von Marcus als Chef und Verwalter geleitet würde, ließ er sich am Ende überreden.
»Betrachte es doch als einen verdammt guten Witz«, hatte Mathias mit einem Grinsen gesagt. »Der Arsch hat sein Leben lang Mama und uns das Geld vorenthalten, aber am Ende können wir doch dicke von dem leben,
Weitere Kostenlose Bücher