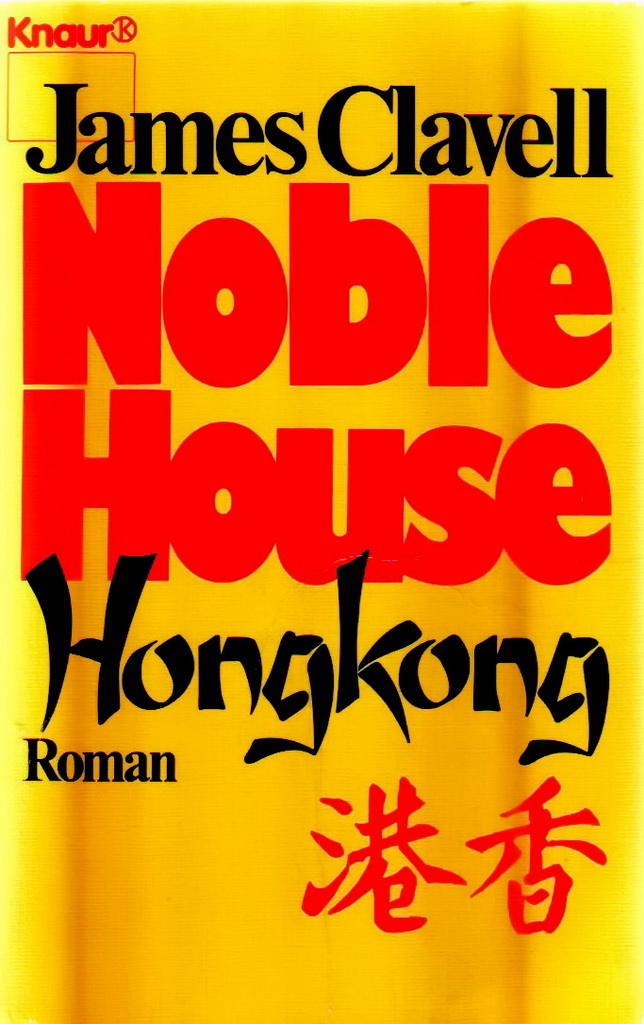![Hongkong 02 - Noble House Hongkong]()
Hongkong 02 - Noble House Hongkong
schwierig – ärger als die Mandarine.«
Wu drehte sich um, als sein Siebenter Sohn an Deck kam. Der junge Mann trug jetzt ein weißes Sporthemd, eine graue Hose und modische Schuhe. »Sei vorsichtig«, rief er ihm barsch zu. »Weißt du auch, was du zu tun hast?«
»Ja, Vater.«
»Gut«, sagte Vierfinger, seinen Stolz verbergend. »Du darfst keinen Fehler machen.«
Er sah seinem Sohn nach, der über die Laufplanken zwischen den Dschunken eilte, bis er, acht Boote weiter, einen behelfsmäßigen Anlegeplatz erreichte.
»Weiß er schon etwas?« fragte Poon leise.
»Nein, noch nicht«, antwortete Wu verdrießlich. »Lassen sich doch diese Klammeraffen mit meinen Gewehren erwischen! Ohne Gewehre war unsere ganze Arbeit umsonst.«
»Guten Abend, Mr. Gornt. Ich bin Paul Tschoy – mein Onkel Wu hat mich gebeten, Ihnen den Weg zu zeigen«, sagte der junge Mann in perfektem Englisch und wiederholte damit die Lüge, die für ihn schon fast Wahrheit war.
Überrascht blieb Gornt stehen, stieg aber dann die unsicheren Stufen hinauf. »Guten Abend«, erwiderte er den Gruß. »Sind Sie Amerikaner? Oder dort nur zur Schule gegangen, Mr. Tschoy?«
»Beides.« Paul Tschoy lächelte. »Sie wissen ja, wie das ist. Vorsicht, diese Bootsdecks sind verdammt glitschig!« Sein richtiger Name war Wu Fang Tschoi, und er war seines Vaters Siebenter Sohn aus dessen Ehe mit seiner Dritten Frau, doch als er geboren wurde, hatte sein Vater Vierfinger Wu einen für einen Bootsbewohner ungewöhnlichen Schritt getan: ihm in Hongkong ein Geburtszeugnis ausstellen lassen, dabei aber den Mädchennamen seiner Frau eingesetzt, ›Paul‹ hinzugefügt und einen seiner Vettern dazu überredet, als Vater aufzutreten.
»Höre, mein Sohn«, hatte Wu gesagt, als Paul alt genug war, um ihn zu verstehen.
»Wenn du an Bord meines Schiffes Haklo sprichst, kannst du mich Vater nennen – aber nie in Anwesenheit eines fremden Teufels. Zu allen anderen Zeiten bin ich dein ›Onkel‹, einer von vielen Onkeln. Verstanden?«
»Ja, Vater. Aber warum? Habe ich etwas falsch gemacht? Es täte mir leid, wenn ich dir Kummer gemacht hätte.«
»Das hast du nicht. Du bist ein guter Junge, und du arbeitest fleißig. Es ist nur eben besser für die Familie, wenn du einen anderen Namen trägst.«
»Aber warum, Vater?«
»Wenn es an der Zeit ist, wirst du es erfahren.« Als er zwölf war und gezeigt hatte, daß er etwas taugte, hatte sein Vater ihn in die Staaten geschickt. »Du sollst jetzt die Lebensweise der fremden Teufel erlernen. Du mußt reden, wie sie reden, schlafen, wie sie schlafen, nach außen hin einer von ihnen sein, aber du darfst nie vergessen, daß alle fremden Teufel minderwertig und kaum als menschliche Wesen anzusprechen sind.«
Paul Tschoy lachte in sich hinein. Wenn es die Amerikaner nur wüßten – vom Tai-Pan bis zum letzten Würstchen –, aber auch die Engländer, Deutschen, Perser, Russen – wenn sie wirklich wüßten, was auch der dreckigste Kuli von ihnen hielt, der Schlag würde sie treffen, sagte er sich zum tausendstenmal. Natürlich haben wir unrecht, sagte er sich. Auch Fremde sind Menschen, und manche sogar kultiviert – auf ihre Art – und uns technisch weit voraus. Aber wir sind nun einmal besser …
»Worüber lächeln Sie?« fragte Gornt, tauchte unter Seilen durch und wich dem Unrat aus, der über alle Decks verstreut war.
»Ach, ich dachte nur gerade, wie verrückt das Leben ist. Heute vor einem Monat habe ich in Malibu Colony, Kalifornien, Wellen geritten. Mensch, Aberdeen ist doch was anderes, stimmt’s?«
»Sie meinen den Geruch?«
»Na klar. Und bei Hochwasser ist es auch nicht viel besser. Außer mir merkt überhaupt keiner was von dem Gestank.«
»Wann waren Sie das letzte Mal hier?«
»Vor zwei Jahren, nach meinem Abschluß als Diplomkaufmann, aber ich scheine mich nicht daran gewöhnen zu können.«
»Wo haben Sie studiert?«
»Zuerst in Seattle. Dann dort Vorbereitungskurse an der Washington-Uni. Dann machte ich den Magister an der Harvard Business School.«
»Das ist sehr schön. Wann haben Sie graduiert?«
»Voriges Jahr im Juni. Mann, ich kam mir vor wie aus dem Gefängnis entlassen! Wenn man in seinen Leistungen nachläßt, ziehen sie einem bei lebendigem Leib die Haut ab! Zwei Jahre die reine Hölle! Dann ging ich mit einem Freund nach Kalifornien, wo wir mit Gelegenheitsarbeiten gerade das Nötige verdienten, um Wellenreiten zu gehen …« Tschoy grinste. »… und dann, vor ein paar
Weitere Kostenlose Bücher