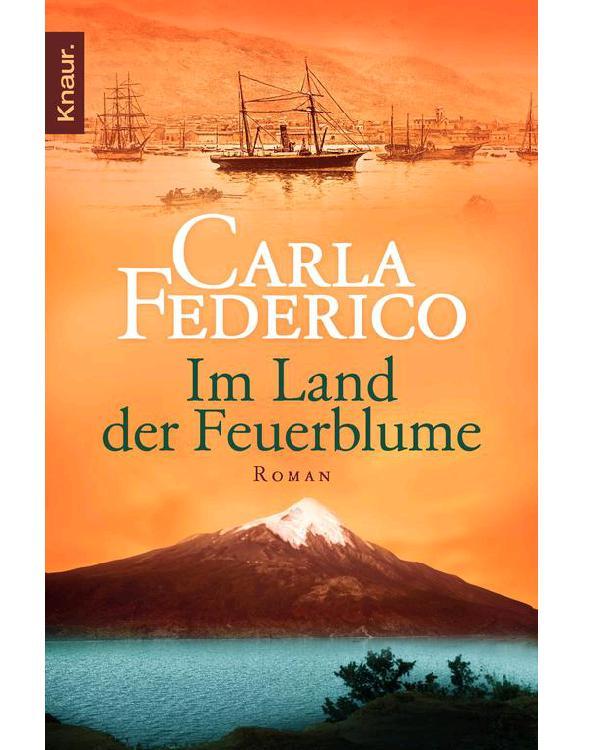![Im Land der Feuerblume: Roman]()
Im Land der Feuerblume: Roman
dreckigen Fetzen Stoff auf – vielleicht der kümmerliche Rest eines einstigen Kühlsegels, vielleicht eine der Segeltuchkappen.
»Gib acht!«, rief sie, als sie die Nägel entdeckte, die darunter verstreut lagen und die genauso rostig waren wie das Gitter.
Er trat zurück, schnupperte angewidert. Noch ein anderer Geruch lag in dem Lagerraum, durchdringender als der faulig-salzige Gestank von Meeresbracke.
»Riechst du das auch?«, fragte er. »Was ist das?«
Elisa blickte sich um. Nach den vielen Stunden in der grellen Sonne hatte sie zunächst nicht sonderlich mehr erkannt als Konturen. Nun gewöhnten sich ihre Augen an das trübe Licht.
In der hinteren Ecke standen mehrere Fässer nebeneinander. Eines war umgefallen, und eine dunkle Flüssigkeit troff daraus. Auf dem Boden hatte sich eine klebrige Pfütze gebildet.
»Ich glaube, das ist Eisenvitriol. Oder Karbolsäure. Man nutzt es zur Reinigung der Schiffe, vor allem von der Notdurft.«
»Dann wird bald jemand hier auftauchen und das Zeugs holen!«, rief der Junge eifrig. »Bevor das Schiff ablegt, meine ich!«
Elisa nickte; sie wollte den Zweifel nicht eingestehen, der sich in ihr ausbreitete. Nicht nur, dass die Fässer hier leer schienen – das »Zeugs«, wie Leopold es nannte, war also gewiss auch zur Genüge in anderen Lagerhallen vorrätig, weswegen niemand gezwungen sein würde, es von hier zu holen. Obendrein hatte der Gehilfe des Hafenmeisters keinerlei Eile an den Tag gelegt.
Elisa spähte in Richtung der Gitterstäbe; die schlurfenden Schritte des Mannes waren das Letzte gewesen, was sie von dort gehört hatte. Die Geräusche, die vom Hafen kamen – die Stimmen, die kreischenden Möwen, die plätschernden Wellen – klangen nur gedämpft durch die Holzwände und ließen sich kaum voneinander unterscheiden.
»Heißt du wirklich Leopold?«, fragte sie, um sich abzulenken.
Er zog die Stirn kraus. »Glaubst du, ich lüge?« Er klang gekränkt.
»Dann hätte ich dir wohl kaum geholfen«, beschwichtigte sie ihn hastig.
»Von Helfen kann wohl keine Rede sein, sonst wären wir nicht hier«, meinte er seufzend. »Du hast dich lediglich als meine Schwester ausgegeben – und das war eine Lüge.«
Damit hatte er zweifelsohne recht, doch darüber, was diese Lüge ihr eingebracht hatte, wollte sie lieber nicht nachdenken.
»Also … Leopold …«, setzte sie an.
»Meine Geschwister nennen mich Poldi.«
»Also … Poldi …«
Nachdem er das Tuch wieder hatte fallen lassen, war er steif im Raum stehen geblieben, sichtlich darum bemüht, nichts anzufassen. Nun trat er forsch zur Tür und rüttelte an den rostigen Stäben – vergebens. Als er die Hände wieder zurückzog, waren sie mit roten Streifen übersät.
»Das Schiff legt bald ab«, stellte Poldi fest. Seine Stimme kämpfte mit Panik – und eben diese stieg auch in ihr hoch, legte sich wie ein Kragen um ihren Hals, der immer enger zu werden drohte und ihr die Luft abschnürte.
Ruhig versuchte sie dagegen anzuatmen.
»Wollt ihr auch nach … Chile?«, fragte sie.
Sie hatte den Namen des Landes bis jetzt nur sehr selten ausgesprochen, als wäre er zu kostbar, um ihn leichtfertig in den Mund zu nehmen, ja, als verlangten die ungeheuerliche Ferne und die ungeheuerliche Fremde ähnliche Ehrfurcht wie ein Gebet.
Poldi nickte knapp. »Eigentlich haben wir uns für Neu-York entschieden. Der Eider-Hans aus unserem Dorf ist dorthin gegangen. Er hat sogleich Arbeit gefunden, schrieb er in einem Brief. Für die Eisenbahn würde er jetzt arbeiten. Und er verdient so viel, dass er kein hartes Schwarzbrot mehr essen muss. Pasteten kann er sich jetzt leisten, und zwar aus feinstem Weizenmehl.« Er schmatzte genießerisch mit den Lippen, ehe er fortfuhr. »Die Fahrt dorthin dauert auch nur fünfzig Tage, nicht so lange wie nach Chile. Aber mein Großvater reist mit uns. Und er ist weit über sechzig.«
Elisa wusste, was er meinte. In einem der Amtsblätter, die sie und ihre Mutter über Monate sorgfältig durchforstet hatten, war zu lesen gewesen, dass in Nordamerika keine Menschen willkommen waren, die mehr als sechzig Jahre zählten. Doch obwohl in ihrer eigenen kleinen Familie alle im passenden Alter gewesen wären, hatten auch sie sich für Chile entschieden und nicht für Neu-York. Die meisten würden dorthin gehen, hatte ihre Mutter gesagt, und längst seien die Fremden dort nicht mehr so erwünscht wie einst. Die Lobeshymnen auf die neue Heimat, die in den Briefen stünden, müsste
Weitere Kostenlose Bücher