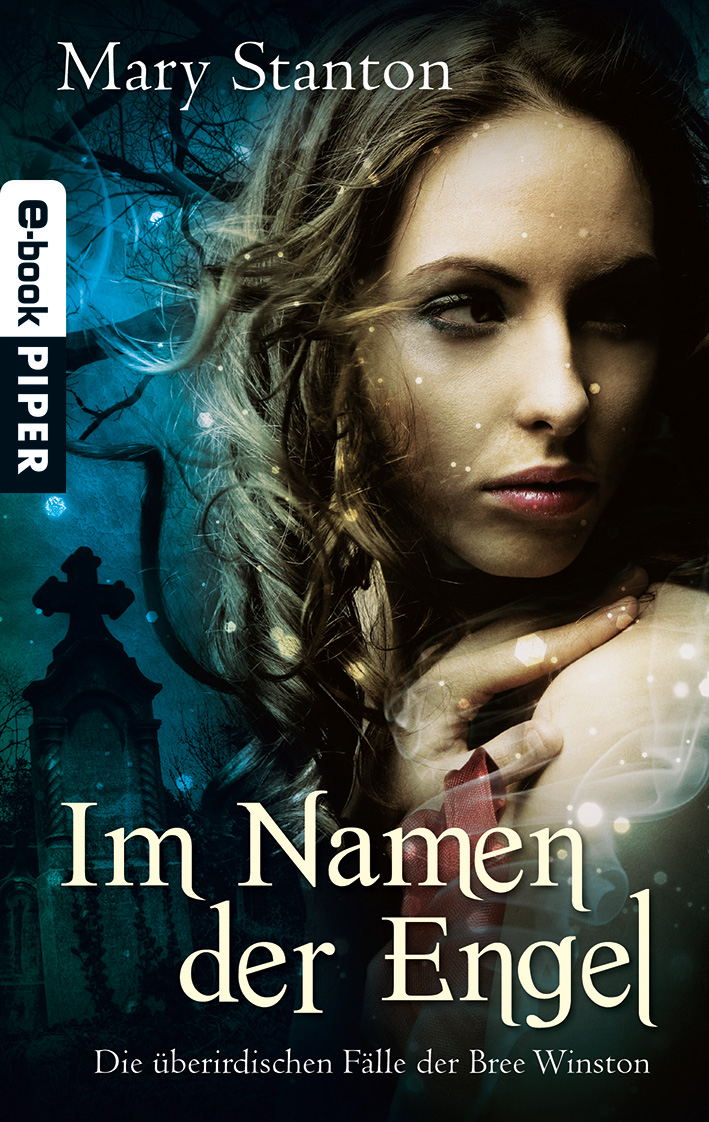![Im Namen der Engel]()
Im Namen der Engel
die Frau nicht mag, davon abbringen lassen, den Fall mit ihren Augen zu sehen.« Eine Zeit lang herrschte Schweigen im Zimmer. »Okay«, sagte Bree schließlich, »wir werden Folgendes machen. Ron? Ich möchte, dass Sie Mr. Skinners Privatsekretärin aufsuchen und sie ausfragen.«
Ron runzelte die Stirn. »Sie meinen diese unglaublich aufgetakelte Blondine, die im Penthouse des Skinner-Gebäudes wohnt?«
»Nein, nein, nein. Das ist Chastity McSoundso.«
»McFarland«, stellte Petru pedantisch richtig.
»Ja. Ich meine seine richtige Sekretärin, die für seinen Terminkalender zuständig war. Liz Overshaw müsste Ihnen eigentlich sagen können, wo sie zu finden ist. Ich möchte wissen, was er in seinen letzten zwei Lebenstagen gemacht hat, und zwar Stunde für Stunde … nein! Minute für Minute!«
Sie warf einen Blick auf die Masse von Daten, die Ron und Petru bereits zusammengetragen hatten. »Als Nächstes nehmen wir dann all dieses Zeug sorgfältig unter die Lupe, um nach Unstimmigkeiten und unklaren Fakten oder Verhaltensweisen Ausschau zu halten. Petru, es wäre toll, wenn Sie ein Diagramm oder einen Zeitplan oder etwas in der Art erstellen könnten, das uns eine Vorstellung von Skinners Leben vermittelt.«
»Und was haben Sie vor?«, fragte Ron.
»Ich werde die Verdächtigen befragen, einen nach dem anderen. Mit Grainger fange ich an.«
»Glauben Sie, Sie können da einfach so reinplatzen und ihn verhören?«, fragte Ron voller Bewunderung. »O Bree, Sie haben ganz schönen Mumm .«
»Jennifer war damals auf der Schule ein paar Klassen über mir. Und ich kenne ihren kleinen Bruder. Wenn ich die Gründe ein bisschen frisiere, wird sie mich, glaube ich, empfangen. Wenn es geht, werde ich dieses Treffen für morgen Nachmittag arrangieren. Und vormittags werde ich Carlton Montifiore auf einer seiner Baustellen aufspüren.«
»Exzellent«, sagte Ron, »aber legen Sie doch beide Treffen auf den Nachmittag. Dann hätten wir vormittags Zeit für ein paar kleine Einkäufe.«
Bree schlug mit den Händen auf den Tisch. »Ron! Was soll diese ganze Aufregung um die Art und Weise, wie ich mich kleide?«
»Sie treten unvorteilhaft auf.« Er kniff die Augen zusammen, was er vermutlich für tough hielt. »Ich möchte Sie nur mal eins fragen: Haben Sie außer Schwarz und Weiß auch noch etwas anderes in Ihrem Kleiderschrank? Irgendetwas, das ein bisschen mehr nach Farbe aussieht?«
»Jeans«, gab Bree sofort zurück. »Und ein blau-weißes T-Shirt von der Duke University.«
Ron riss die Arme hoch und machte eine »Sehen-Sie-was-ich-meine«-Geste. »Wie dumm von mir. Das ist natürlich genau die richtige Kleidung für einen Auftritt vor Gericht. Schätzchen, bei diesem Overshaw-Fall werden Sie gegen einige der mächtigsten Familien von Savannah antreten. Nun gibt es zwei Arten, sich zu kleiden, um Eindruck zu machen. Die eine besteht darin, Tennisschuhe, T-Shirt und zerlumpte Jeans zu tragen, wenn man ins Weiße Haus eingeladen wird. Damit kann man durchkommen, wenn man – sagen wir mal – Steve Jobs heißt. Die andere besteht darin, sich anzuziehen, als sei man der Präsident einer kleinen südamerikanischen Republik. Sodass man Selbstvertrauen und Autorität ausstrahlt. Etwas darstellt .«
Bree blickte an sich herab. Ihr ganzes Leben als Erwachsene war davon bestimmt gewesen, dass sie viel zu tun hatte – an der Universität, in der Kanzlei ihres Vaters; und jetzt, da sie eine eigene Kanzlei hatte, war sie sogar noch beschäftigter. Jedes Mal, wenn sie im Wartezimmer ihres Zahnarztes eine Ausgabe der Vogue oder Oprah in die Hand nahm, war sie furchtbar eingeschüchtert von all den Dingen, die man anstellen musste, um richtig cool zu wirken. Elegant und kultiviert auszusehen war ein Fulltime-Job. Deshalb war sie zu dem Schluss gekommen: je weniger Auswahl, desto besser. Ihr Kleiderschrank ent hielt fünf teure Hosenanzüge von Armani in Grau, Schwarz und Stahlgrau sowie zwei Dutzend seidene T-Shirts von Eileen Fisher in unterschiedlichen Weißtönen. Das machte es ihr sehr leicht, sich für die Arbeit anzuziehen. Und war extrem langweilig.
Sie sah Ron an. »Welche südamerikanische Republik würde Ihnen denn vorschweben?«, fragte sie in honigsüßem Ton.
»Sie sind sauer auf mich«, erwiderte er. »O Gott. Dabei habe ich doch bloß versucht zu helfen.«
»Ich bin nicht sauer auf Sie. Ich bin Ihnen dankbar. Für den Hinweis. Wenn auch nicht unbedingt für die Art und Weise, wie Sie es formuliert
Weitere Kostenlose Bücher