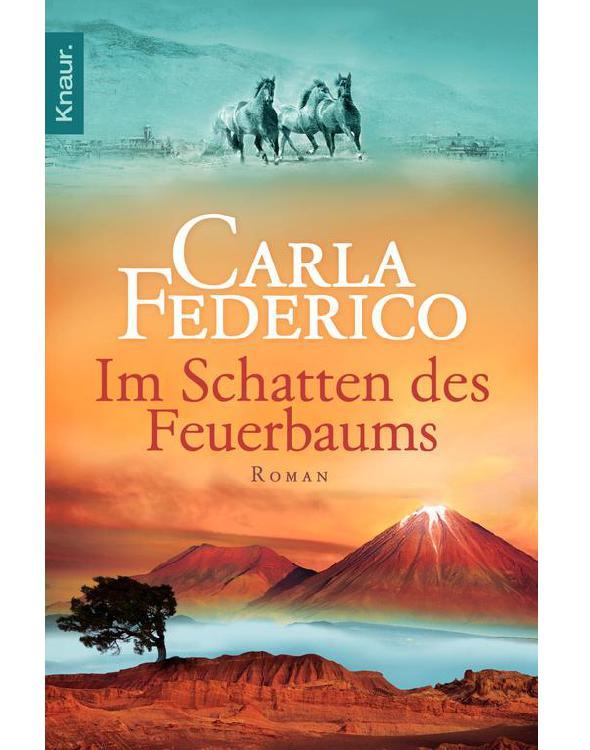![Im Schatten des Feuerbaums: Roman]()
Im Schatten des Feuerbaums: Roman
Prolog
Patagonien 1920
H eulend machte der Wind Jagd auf die Wolken. Dick und weiß hatten sie sich am Himmel zusammengeballt und am Ende des Horizonts leicht bläulich verfärbt. Nun fuhr der Wind durch sie hindurch wie die Hütehunde durch die Schafherde und zerrte so lange an ihnen, bis strahlend blauer Himmel dahinter hervortrat, der nur dann und wann von der Ahnung eines Rostbrauns unterbrochen wurde. Auch als der Tag sich schließlich dem Ende zuneigte, war der Wind nicht bereit, der Nacht zu weichen.
Das Licht wurde trüber, aber Aurelia hörte nicht auf, zu malen. Sie achtete nicht auf ihre flatternde Kleidung, nicht auf Sand und Staub, die ihr ins Gesicht prasselten, nicht darauf, dass die Leinwand – aus gebleichter Guanakohaut gefertigt – vom Rahmen gezerrt zu werden drohte.
Ruhig trug sie Farbe um Farbe auf und malte, was sie sah: die braune Erde, den leuchtenden Feuerbaum, das rote Abendglühen, den sich verdunkelnden Himmel. Die Farbe für Letzteren war aus dem Saft der Calafaten gemacht, blauen Beeren, die süß schmeckten und all jene, die magere Kost gewohnt waren, zu einem Sprichwort verleitet hatten: Wer je diese Beeren gegessen hätte, sei Patagonien verfallen und käme immer wieder zurück.
Nicht nur die Farben der Beeren hatte sie der Natur entliehen, die hier karg, wild und widerstandsfähig war, auf einem Fleckchen Erde, das die einen verwunschen und einsam nannten, das für andere aber – so wie sie – ein Sehnsuchtsland war. Auch die Erde schenkte viele Farben, denn nur für den ungeübten Betrachter verhieß sie eintöniges Braun. Für den Maler jedoch gab es in den Schichten des Bodens viele geheime Schätze zu entdecken, sämtliche Nuancen von Ocker, Grün, Grau, Braun und Rot.
Aurelia liebte die Farben und den Geruch, den sie verströmten, und sie liebte die Erde, auf der sie stand, ohne zu wanken. Nicht länger fürchtete sie, diese Erde würde an ihr kleben, würde die Fingernägel verdunkeln und würde für andere nicht Zeichen ihrer Heimatverbundenheit sein, sondern schlichtweg von Dreck und Armut künden. Diese Angst war von den letzten Jahren in Patagonien ebenso verscheucht worden wie die Wolken am Himmel vom Wind.
Nach diesem Himmel, nach dem struppigen Steppengras, nach den violett schimmernden Spitzen der Kordilleren, nach den rötlichen Hügeln und dem sumpfigen Teich in der Ferne malte sie zwei Menschen. Sie standen im Schatten eines Feuerbaums mit leuchtenden Blüten, unter deren Fülle sich die Äste bogen, und ledrig wirkenden, dunkelgrünen Blättern, die im Wind wogten. Da sie nur von hinten zu sehen waren, war nicht zu erahnen, ob sie alt oder jung waren, lächelten oder weinten, zu den Reichen oder zu den Armen gehörten. Einzig die Kleidung verriet, dass sie Mann und Frau waren.
Aurelia hatte viele ähnliche Bilder gefertigt, jüngstens erst hochgelobte Bilder, die manche in die Nähe der naiven Malerei rückten, andere als faszinierendes Beispiel für den Kolonialismus bezeichneten, wieder andere dem Naturalismus zuordneten. Nicht zuletzt wegen der Farben und der Guanakohaut der Leinwand galten sie als einzigartig: Material und Motiv schienen eins zu sein. Fast immer wählte sie das gleiche Motiv – die Weite Patagoniens und zwei Menschen, die inmitten der Landschaft standen, winzig anmutend, weil in diesen Breitengraden die Natur um so viel mächtiger scheint als der Mensch. Die beiden waren ganz allein, aber nicht einsam, denn sie hatten einander, hielten sich an den Händen und liebten sich so sehr, dass sie – für die Dauer, da sie im Wind standen und der sinkenden Sonne zusahen – einander genug waren.
Aurelia trat zurück, nachdem sie das Bild vollendet hatte, und es traten Tränen in ihre Augen – Ausdruck von Schmerz, den diese Liebe in ihr Leben gebracht hatte, und Ausdruck von Dankbarkeit, weil sie diese Liebe erfahren hatte dürfen.
Das Bild verschwamm vor ihren Augen, sie hörte den Wind nicht länger stöhnen.
»Tiago«, murmelte sie. »Tiago …«
Erst nach einer Weile klärte sich ihr Blick wieder, und sie konnte das Bild etwas nüchterner betrachten. Vielleicht war es das schönste, das sie je gemalt hatte. Ja, die Farben waren so kräftig, verhießen Weite und Wildheit, Liebe und Fruchtbarkeit, Einsamkeit und Freiheit, Luxus und Armut, Glück und Trauer, Gewinn und Verlust. All das hatte sie erfahren, vieles davon überreich, und so wurden aus den Farben des Bildes gleichsam die Farben ihres Lebens.
Erstes Buch:
Die
Weitere Kostenlose Bücher