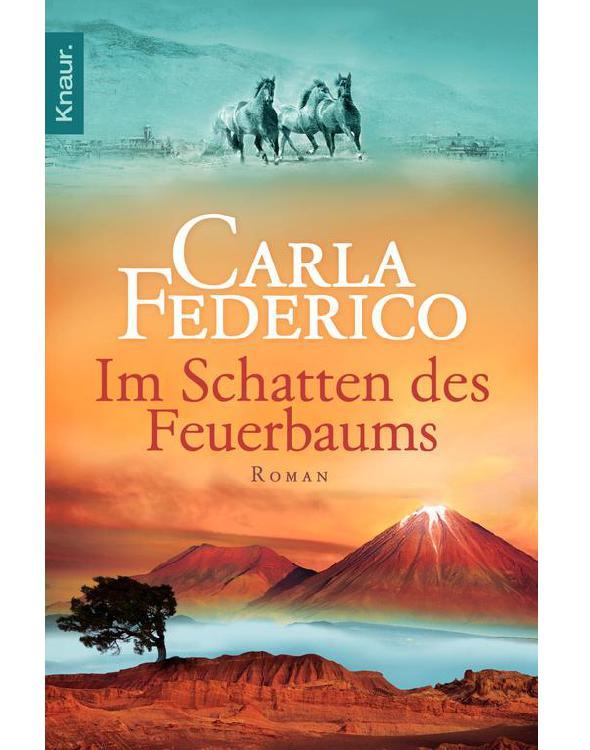![Im Schatten des Feuerbaums: Roman]()
Im Schatten des Feuerbaums: Roman
Ihr Leben war vage wie ein Traum; all die Jahre ihrer Jugend auf der Estancia schmolzen zu wenigen Stunden. Übermächtig wurde einzig die Erinnerung an ihre Kindheit, der sie kaum entwachsen schien.
Ein Schuss war gefallen … jetzt … und damals auch. Ihre Mutter Rita hatte ihren Vater Esteban erschossen, sie sah es deutlich vor sich, eine gerechte, notwendige Tat zwar, nachdem dieser sie entführt und gefangen gehalten hatte, aber trotzdem ein Mord. Sie war so erleichtert gewesen, den unheimlichen Mann reglos zu Boden sacken zu sehen – aber da war auch unendlich viel Grauen gewesen, als sich eine Blutlache um ihn ausbreitete.
Aurelia wand sich zitternd, spürte einen stechenden Schmerz – und hörte plötzlich eine Stimme durch das Grau dringen, in dem sie gefangen war. Nicht die Stimme ihrer Mutter, nicht die von Esteban … sondern ganz überraschend Tiagos Stimme.
»Aurelia … Aurelia, bist du wach? Geht es dir gut? Ach, ich habe mir solche Sorgen gemacht! Als ich sah, wie du reglos auf dem Boden gelegen hast – da dachte ich schon …« Er brach ab. »Aber die Ärzte meinten, dass dich die Kugel nur gestreift hat«, erklärte er nach einer Weile mit zitternder Stimme. »Du hast etwas Blut verloren, aber du musstest nicht operiert werden.«
Aurelia blinzelte, öffnete die Augen. Aus dem Grau erstanden die Konturen seines Gesichts, seines geliebten Gesichts. Sie ahnte, dass sie in einem Krankenhaus war und Tiago sie dorthin gebracht haben musste, und konnte sich auch wieder an das erinnern, was passiert war.
Victoria … als Letztes hatte sie doch Victoria gesehen …
Als sie sich mühsam aufrichtete, explodierte in ihrem Kopf ein glühender Schmerz.
»Nicht! Streng dich nicht an!«
»Was ist mit Victoria? Und wieso … wieso bist du hier?«
Die erste Frage konnte er nicht beantworten, aber er berichtete stammelnd, dass er zufällig Andrés getroffen und dieser ihm erzählt hatte, wie sie trotz der gewaltsamen Ausschreitungen in Richtung der Población gelaufen war. Er hatte sich nicht davon abhalten lassen, ihr sofort zu folgen. »Wie leichtsinnig du warst, Aurelia!«, schloss er. »Du musst mehr auf dich achtgeben, du darfst dich nicht in solche Gefahren begeben. Es war so schrecklich, wie du auf dem Boden gelegen hast, voller Blut und …«
Er brach ab. In seinen Augen glitzerten Tränen.
Sie schloss kurz die Augen, sah blitzartig Bilder von den Ausschreitungen – und sah noch mehr als das. Sie sah auch Andrés’ Gesicht, wie er mit ihr gemeinsam vor dem Haus der Familie Brown y Alvarados gestanden hatte …
»Dein Vater«, presste sie heiser hervor; ihre Lippen waren so trocken und klebten aufeinander, »dein Vater ist einer der reichsten und mächtigsten Männer Chiles …«
»Pst! Reg dich nicht auf! Nicht jetzt!«
Sie schwieg, aber versuchte wieder, sich aufzusetzen, und diesmal war der Schmerz nicht ganz so heftig. »Warum bist du hier bei mir?«, fragte sie wieder. »Es ist nicht richtig, wir haben doch keine Zukunft … ich bin bloß die Tochter eines patagonischen Schafzüchters und einer …«
Und einer Mapuche, wollte sie sagen, hielt jedoch inne.
»Was redest du da nur?«, rief Tiago. »Ich war immer anders als meine Familie. Ich habe mich nie den Befehlen meines Vaters gefügt. Ich lasse mir von ihm nicht vorschreiben, mit wem ich meine Zeit verbringe.«
»Aber die Escuela … du bist dort kein Professor … du bist nur …«
Er senkte seinen Blick.
»Ich bin nur Student«, bekannte er verlegen, »und es tut mir leid, das ich dich darüber im Unklaren gelassen habe. Aber ich wollte nicht, dass du mich nur als Sohn reicher Eltern siehst, dass du mich mit dieser Achtung, aber zugleich dieser Scheu ansiehst wie alle, die um meine Herkunft wissen. Wie groß das Vermögen meines Vaters auch ist – es darf nicht bestimmen, wer ich bin. Ich bin Maler … versuche zumindest, einer zu sein. Und … und ich liebe dich, Aurelia.«
In ihrem Kopf rauschte es. Sie fühlte keinen Schmerz mehr, keine Erschöpfung, keine Angst.
»Tiago …«, stammelte sie.
»Gewiss, es war eine Lüge, dass ich dir vorgemacht habe, ich sei kein Student, sondern einer der Professoren. Aber ich sah keine andere Möglichkeit, um Zeit mit dir zu verbringen, um dich besser kennenzulernen, und irgendwann war es zu spät, dir die Wahrheit anzuvertrauen. Ich dachte, du würdest mich für meine Lüge verachten – und außerdem … außerdem tat es so gut, einmal alles zu vergessen,
Weitere Kostenlose Bücher