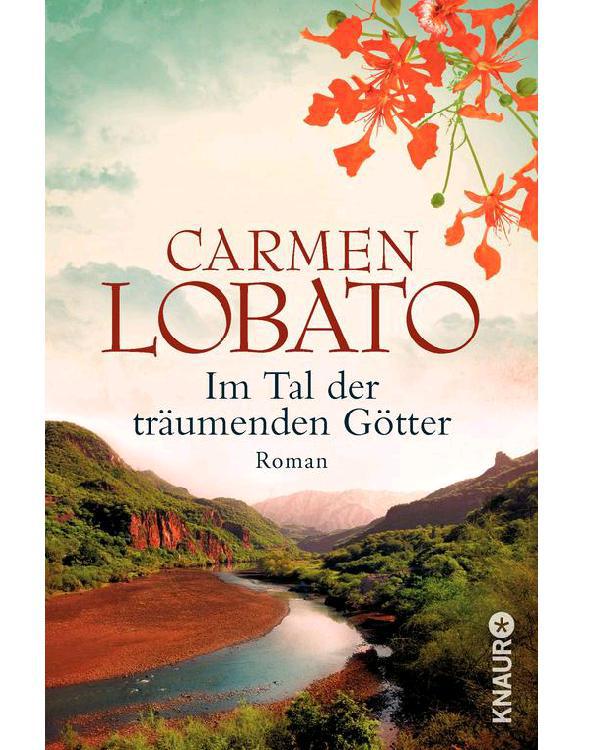![Im Tal der träumenden Götter: Roman (German Edition)]()
Im Tal der träumenden Götter: Roman (German Edition)
als um die Haut von dem verdammten Dzul?«
»Nein«, sagte Anavera wieder und presste die Lippen auf seinen anderen Schuh.
Iacinto Camay fluchte, ergriff ihre Haare und riss ihr den Kopf in die Höhe. »Hör zu, ich kann dieses Schwein nicht ungeschoren lassen, und wenn du noch so sehr bettelst. Keiner meiner Männer, die unter seinesgleichen gelitten und ihre Brüder und Freunde verloren haben, würde es begreifen, verstehst du das nicht?«
»Doch.« Anavera konnte vor Tränen kaum noch sprechen. »Bitte schlagen Sie ihn nicht. Bitte lassen Sie ihn mir. Ich verspreche Ihnen, er tut niemandem mehr weh.«
Sie hörte den Tatich seufzen, dann spürte sie wieder seine Hand auf ihrem Kopf. »Du bist unsäglich, weißt du das? Aber meinetwegen, wenn du jetzt endlich aufstehst, lasse ich ihn billig davonkommen. Er kassiert seine drei Dutzend, davon wird er nicht sterben. Dann kannst du ihn wiederhaben, auch wenn ich dir lieber jeden Mann aus diesem Dorf schicken würde.«
Anavera nahm ihre Kraft zusammen und stand auf. Sie konnte noch immer nicht aufhören zu weinen, doch sie schrie nicht mehr. »Ich will nach draußen«, sagte sie zu Iacinto Camay.
»Du willst dir das ansehen?«
»Ja«, antwortete sie. Sie wollte nichts weniger als das. Aber sie fand, sie hatte keine Wahl.
»Weißt du, warum ich dir in allem deinen Willen lasse?«, fragte er wütend. »Weil ich deinen Vater achte, wer immer er ist. Weil ich nicht will, dass du deinem Vater sagst, du seist hier anders behandelt worden als eine Fürstentochter.«
»Danke«, sagte Anavera. »Mein Vater ist Benito Alvarez, der Gouverneur von Querétaro. Ich werde ihm sagen, dass Sie mich behandelt haben, wie er Ihre Tochter behandeln würde.«
»Wenn die Leute von deinem Dzul zahlen.«
»Ja, wenn sie zahlen.«
»Ansonsten schicke ich dich allein zurück.«
»Nein«, sagte Anavera und trat an ihm vorbei aus der Hütte.
Sie brauchte all ihre Beherrschung, um nicht die Hände auf die Ohren zu pressen, während sie durch das Dorf ging. In ihrem Rücken spürte sie die Blicke der Frauen, während sie in die Richtung ging, aus der das entsetzliche Schnalzen der Peitsche kam.
Der Mahagonibaum stand hinter der letzten Choza, zwischen zwei blühenden Feldern. Er war tot, kein Blatt mehr an seinen Zweigen, das wertvolle Holz verdorrt. Der Ast, an den Jaimes Hände gefesselt waren, war so morsch, dass er ihn mit einer Bewegung hätte abbrechen können. Aber das hätte ihm nichts genutzt, und er hätte es nicht getan. Sein Rücken war breit und kraftvoll, nur in der Taille schmal. Schön, dachte Anavera und weinte. Die Schnur der Peitsche traf die verkrampfte rechte Schulter und pflügte die Haut auf, zog eine blutrote Furche. Der Mann, der ihn schlug, rief eine Zahl auf Mayathan.
Sie wollte seinen Rücken nicht ansehen, sondern nur sein Gesicht, das er zur Seite gedreht hielt. Aber zuzusehen, wie sein Gesicht sich verzerrte, war nicht weniger schlimm. Die Kiefer spannten sich, bis sie unnatürlich heraustraten, und als die Peitsche ihr Zerstörwerk getan hatte und an seinen Beinen hinunterglitt, lief ihm Blut aus dem Mundwinkel. Er zerbeißt sich die Zunge, dachte Anavera. Dieser dumme Mann zerbeißt sich die Zunge, weil er glaubt, er ist ohne Würde, wenn er schreit. Die lederne Schnur, die ihr unglaublich schwer vorkam, traf von neuem und schleuderte seinen Oberkörper nach vorn. Sie wollte nichts davon sehen und sah alles – die Beine, die kämpften, um nicht einzubrechen, die steinharten Muskeln von Rücken und Schultern, die verschlungenen, gefesselten Hände und das vor Schmerz verzerrte Gesicht.
Der Mann mit der Peitsche sah nichts. Er schlug wieder zu. Und wieder und wieder.
»Warum tust du dir das an?«
Anavera fuhr herum und sah Iacinto Camay hinter sich stehen. »Es ist genug jetzt«, schrie sie ihn an. »Wer oder was wird besser davon?« Dann lief sie das letzte Stück Weges hinauf, an dem Peiniger vorüber, der im letzten Augenblick die Peitsche herunterriss. »Schluss!«, schrie sie so wild, dass ihr die Stimme brach, griff nach der Fessel um Jaimes Gelenke und versuchte sie aufzuknoten. Sie ließ sich nicht lösen. Aber der Ast brach ab.
»Anavera«, stöhnte Jaime kaum verständlich. »Du darfst das nicht …«
»Du hältst den Mund«, schrie sie ihn an und schlang die Arme um ihn, drückte ihn an sich, ohne sich darum zu scheren, ob sie seine Schmerzen verschlimmerte. »Du törichter, vernagelter Mann hältst jetzt den Mund.«
Sie zwang ihm den
Weitere Kostenlose Bücher