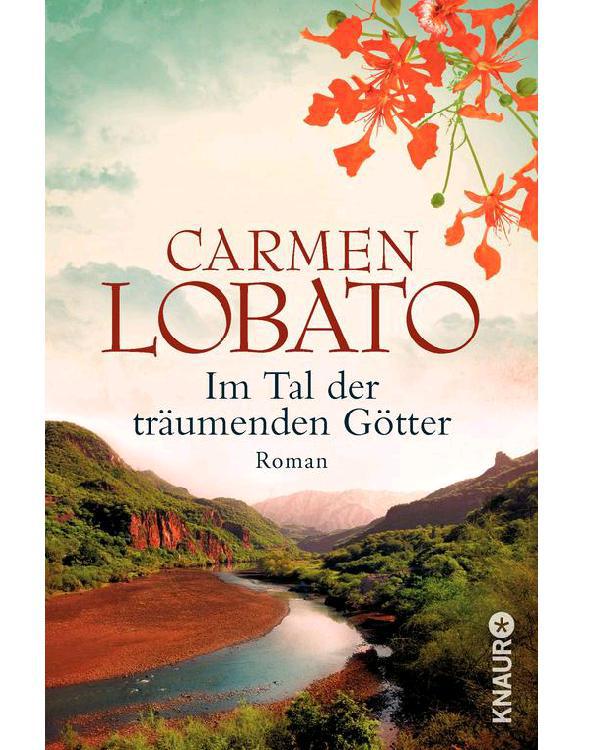![Im Tal der träumenden Götter: Roman (German Edition)]()
Im Tal der träumenden Götter: Roman (German Edition)
ihn jetzt nicht im Stich lassen. Wenn der Präsident will, dass ich täglich bei ihm deswegen vorspreche, dann muss ich es tun, so wahnwitzig und sinnlos es erscheint.«
»Ich verstehe dich«, sagte Josefa und war stolz auf jedes Wort. »Aber in der letzten Woche, ehe wir nach Querétaro fahren, essen wir doch zusammen, oder? Bis dahin ist meine Schrift fertig. Ich bin so gespannt, was du davon hältst.«
»Nicht halb so gespannt wie ich«, erwiderte er und versprach, sich den Abend unter allen Umständen freizuhalten.
Sie bestellten einen Tisch in einem Restaurant kurz vor Chapultepec, wo er es schöner fand als in der lärmenden Innenstadt, inmitten der Clique des Präsidenten. Josefa lebte darauf hin. Sie träumte noch immer von Jaime Sanchez Torrija, aber die Tage brachte sie tapfer herum, indem sie sich ganz und gar in ihre Arbeit grub. Je tiefer sie vordrang, desto mehr wollte sie wissen: Wie war es zu den Verhältnissen, in denen sie lebten, gekommen? Wie war es möglich, dass ein Volk sein Land an ein anderes verlor und noch nach Hunderten von Jahren unter der Knute der Eroberer lebte? Sie bat Onkel Stefan in einem Brief um Material zur Geschichte Mexikos, und er kam persönlich und brachte ihr einen hohen Stapel Bücher.
In ihrer Begeisterung ließ sie ihn ein paar Seiten ihres Textes lesen, von dem er ehrlich beeindruckt schien. »Nicht dass ich viel davon verstehe«, sagte er, »aber mir scheint, du hast echtes Talent.«
»Glaubst du das wirklich?«, bestürmte sie ihn. »Meinst du, es wird meinem Vater gefallen?«
Nachdenklich musterte er sie, bis er nach einer Weile lächelte. »Es ist nicht ganz leicht mit deinem Vater, nicht wahr? Als ich jung war, habe ich mich in seiner Nähe immer ein bisschen kleinlaut gefühlt, weil er so überragend war. Ich habe gedacht: Der Mann muss aus Stahl sein, er steckt alles weg, was wir ihm antun, ohne seine erstaunliche Würde zu verlieren. Er ist viel klüger als wir, macht nie schlapp, und am Ende besitzt er auch noch die Großmut, uns zu verzeihen. Um ehrlich zu sein, mir geht es manchmal heute noch so.«
»Mir auch«, entfuhr es Josefa. »Ich wünschte, ich könnte einmal etwas tun, das gut genug für ihn ist.«
»Das tust du unentwegt«, erwiderte Stefan. »Dein Vater kann nichts dafür, dass wir ihn auf einen Sockel stellen. Er sieht sich nicht so, und er fühlt sich nicht wohl dort oben. Und dich bewundert er mehr als du ihn.«
Es fiel Josefa zwar schwer, das zu glauben, aber ihre Hoffnung, ihr Text könne dem Vater imponieren, wuchs. Sie dankte Onkel Stefan für die Bücher.
»Ich bin froh, dass du dich dafür interessierst«, sagte er. »Dass du dieses Land samt seiner Geschichte als deines betrachtest.«
»Wie sollte ich das denn nicht tun?«, fragte Josefa verwirrt. »Ich bin hier geboren worden, und meine Eltern sind Mexikaner.«
»Ja, natürlich«, beschwichtigte er. »Es ist nur so, dass es mir und Josephine nie ganz gelungen ist, uns in Mexiko zugehörig zu fühlen, auch wenn wir wie du hier geboren sind. Aber das ist ja Unsinn – deine Mutter und Felix haben es geschafft, und für dich ist es völlig selbstverständlich.«
Als sie ihn zur Tür brachte, gingen sie an dem goldgerahmten Spiegel vorbei. Ihr Blick fiel auf ihre beiden Gesichter, und erschrocken stellte sie fest, wie ähnlich sie sich sahen. Nicht im Schnitt der Züge oder im Ausdruck, wohl aber in der zarten Helligkeit, die man in Mexiko so gut wie nie zu sehen bekam. Wie oft hatte Josefa sich als Kind gewünscht, so auszusehen wie ihre Geschwister, ihre Vettern und Basen. Sie glaubte zu begreifen, was ihr Onkel gemeint hatte, doch sie schüttelte es ab. Sie war ihres Vaters Tochter. Er liebte sie, und sie, nicht die leiblichen Kinder, hatte sein Talent geerbt.
Der Text wuchs. Täglich füllte sie mehrere Seiten, und eines Nachmittags, drei Tage vor dem Treffen mit ihrem Vater und fünf Tage vor der Abreise nach Querétaro, schrieb sie einen klingenden, prägnanten Satz und stellte fest, dass es der letzte war. Das Gefühl war überwältigend. Am liebsten wäre sie auf der Stelle in den Nationalpalast gelaufen und hätte den wundervollen Moment mit dem Vater geteilt. Flüchtig erwog sie, Felice herüberzurufen, die von ihrer Arbeit, die sie irgendwo in der Stadt verrichtete, schon zurück war, aber Felice würde kein Wort von alledem verstehen. Ihr blieb nichts übrig, als sich zu gedulden – und umso schöner würde es in drei Tagen sein.
Eine Idee kam ihr. Weshalb sollte
Weitere Kostenlose Bücher