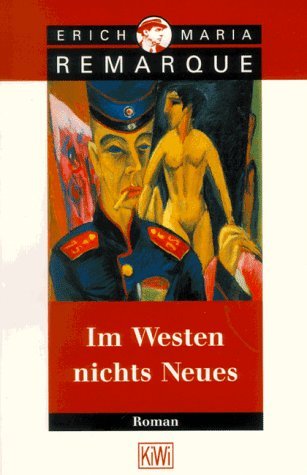![Im Westen Nichts Neues]()
Im Westen Nichts Neues
ihn heben kann.
So krieche ich in die entfernteste Ecke und bleibe dort, die Augen starr auf ihn gerichtet, das Messer umklammert, bereit, wenn er sich rührt, wieder auf ihn loszugehen – aber er wird nichts mehr tun, das höre ich schon an seinem Röcheln.
Undeutlich kann ich ihn sehen. Nur der eine Wunsch ist in mir, wegzukommen. Wenn es nicht bald ist, wird es zu hell; schon jetzt ist es schwer. Doch als ich versuche, den Kopf hochzunehmen, sehe ich bereits die Unmöglichkeit ein. Das Maschinengewehrfeuer ist derartig gedeckt, daß ich durchlöchert werde, ehe ich einen Sprung tue.
Ich probiere es noch einmal mit meinem Helm, den ich etwas emporschiebe und anhebe, um die Höhe der Geschosse festzustellen. Einen Augenblick später wird er mir durch eine Kugel aus der Hand geschlagen. Das Feuer streicht also ganz niedrig über das Terrain. Ich bin nicht weit genug von der feindlichen Stellung entfernt, um nicht von den Scharfschützen gleich erwischt zu werden, wenn ich versuche, auszureißen.
Das Licht nimmt zu. Ich warte brennend auf einen Angriff von uns. Meine Hände sind weiß an den Knöcheln, so presse ich sie zusammen, so flehe ich, das Feuer möge aufhören und meine Kameraden möchten kommen.
Minute um Minute versickert. Ich wage keinen Blick mehr zu der dunklen Gestalt im Trichter. Angestrengt sehe ich vorbei und warte, warte. Die Geschosse zischen, sie sind ein stählernes Netz, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Da erblicke ich meine blutige Hand und fühle jähe Übelkeit. Ich nehme Erde und reibe damit über die Haut, jetzt ist die Hand wenigstens schmutzig, und man sieht das Blut nicht mehr.
Das Feuer läßt nicht nach. Von beiden Seiten ist es jetzt gleich stark. Man hat mich bei uns wahrscheinlich längst verlorengegeben.
*
Es ist heller, grauer, früher Tag. Das Röcheln tönt fort. Ich halte mir die Ohren zu, nehme aber die Finger bald wieder heraus, weil ich sonst auch das andere nicht hören kann. Die Gestalt gegenüber bewegt sich. Ich schrecke zusammen und sehe unwillkürlich hin. Jetzt bleiben meine Augen wie festgeklebt hängen. Ein Mann mit einem kleinen Schnurrbart liegt da, der Kopf ist zur Seite gefallen, ein Arm ist halb gebeugt, der Kopf drückt kraftlos darauf. Die andere Hand liegt auf der Brust, sie ist blutig.
Er ist tot, sage ich mir, er muß tot sein, er fühlt nichts mehr – was da röchelt, ist nur noch der Körper. Doch der Kopf versucht sich zu heben, das Stöhnen wird einen Moment stärker, dann sinkt die Stirn wieder auf den Arm zurück. Der Mann ist nicht tot, er stirbt, aber er ist nicht tot. Ich schiebe mich heran, halte inne, stütze mich auf die Hände, rutsche wieder etwas weiter, warte – weiter, einen gräßlichen Weg von drei Metern, einen langen, furchtbaren Weg.
Endlich bin ich neben ihm.
Da schlägt er die Augen auf. Er muß mich noch gehört haben und sieht mich mit einem Ausdruck furchtbaren Entsetzens an. Der Körper liegt still, aber in den Augen ist eine so ungeheure Flucht, daß ich einen Moment glaube, sie würden die Kraft haben, den Körper mit sich zu reißen. Hunderte von Kilometern weit weg mit einem einzigen Ruck. Der Körper ist still, völlig ruhig, ohne Laut jetzt, das Röcheln ist verstummt, aber die Augen schreien, brüllen, in ihnen ist alles Leben versammelt zu einer unfaßbaren Anstrengung, zu entfliehen, zu einem schrecklichen Grausen vor dem Tode, vor mir.
Ich knicke in den Gelenken ein und falle auf die Ellbogen.
»Nein, nein«, flüstere ich.
Die Augen folgen mir. Ich bin unfähig, eine Bewegung zu machen, solange sie da sind.
Da fällt seine Hand langsam von der Brust, nur ein geringes Stück, sie sinkt um wenige Zentimeter, doch diese Bewegung löst die Gewalt der Augen auf. Ich beuge mich vor, schüttelte den Kopf und flüstere: »Nein, nein, nein«, ich hebe eine Hand, ich muß ihm zeigen, daß ich ihm helfen will, und streiche über seine Stirn.
Die Augen sind zurückgezuckt, als die Hand kam, jetzt verlieren sie ihre Starre, die Wimpern sinken tiefer, die Spannung läßt nach. Ich öffne ihm den Kragen und schiebe den Kopf bequemer zurecht.
Der Mund steht halb offen, er bemüht sich, Worte zu formen. Die Lippen sind trocken. Meine Feldflasche ist nicht da, ich habe sie nicht mitgenommen. Aber es ist Wasser in dem Schlamm unten im Trichter. Ich klettere hinab, ziehe mein Taschentuch heraus, breite es aus, drücke es hinunter und schöpfe mit der hohlen Hand das gelbe Wasser, das hindurchquillt.
Er
Weitere Kostenlose Bücher