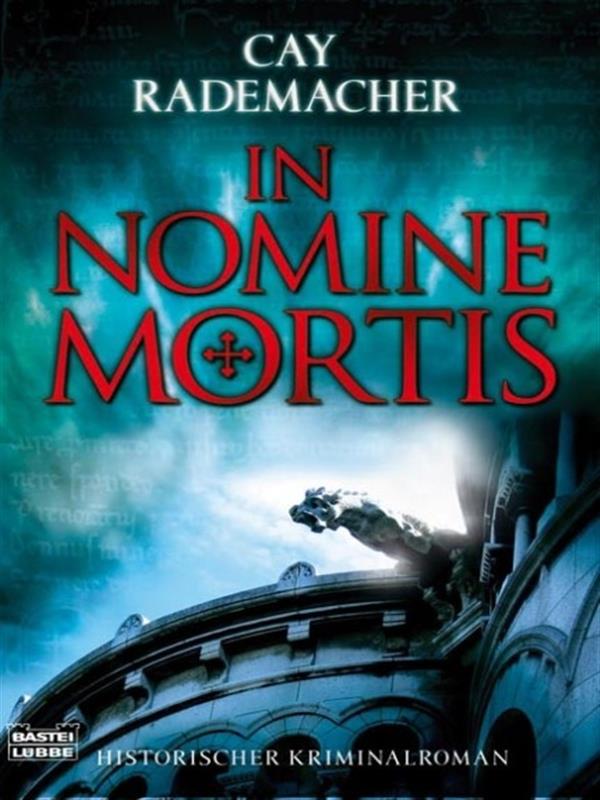![In Nomine Mortis]()
In Nomine Mortis
1
AN EINEM ORT AM ENDE DER
WELT
Anno DOMINI 1388, am Tag des
heiligen Dominicus. Vierzig lange Jahre habe ich mich vor dem Tod
versteckt. Vierzig Jahre lang habe ich geglaubt, dass ich dem düsteren
Schnitter von der Sensenklinge gesprungen wäre. Vierzig Jahre lang
hoffte und betete ich, dass der HERR mir meine Sünden vergeben hätte,
dass ihn das Leuchten in den Augen meiner Frau und das Lachen meiner
Kinder und Enkel so erfreuen, so gnädig und milde stimmen würde
wie mich. Doch SEINE Wege sind unergründlich, SEINE Geduld ist
grenzenlos, SEINE Strafe fürchterlich. Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Ich bin fortgezogen aus
dieser verfluchten Stadt Paris, diesem Sodom und Gomorrha, dieser großen
Hure Babylon. Bin an das Ende der Welt gezogen — ein Ende, von dem
ich doch weiß, dass es nicht das Ende ist. Meine Stube ist
bescheiden, die Decke niedrig, der Kamin verrußt, die grauen
Steinmauern angefressen von der salzigen Luft. Doch wenn ich den Laden vor
meinem Fenster öffne, schweift mein Blick hinaus auf den gewaltigen
Ozean und das rauschende Spiel der Wogen. Das Grollen der Brandung in den
feucht glänzenden Felsen der Steilküste, das Kreischen der Möwen
sind mir ein süßerer Lobpreis SEINER Herrlichkeit als der mächtigste
Hymnus, den meine Brüder je zum weitgespannten Dach unserer Kirche
emporgetragen haben.
Ob einer meiner Brüder
heute noch am Leben ist? Ob mir mein alter Prior, ob mir mein
Novizenmeister, der mich als elternlosen Jungen voll väterlicher
Liebe großzog, vergeben würden, sähen sie mich hier?
Sicher würden sie mit mir beten.
Doch ich will nicht klagen.
Des Menschen Schicksal liegt nicht ganz allein in SEINER Hand, denn wozu
sonst hätte ER uns freien Willen gegeben und die Fähigkeit, das
Gute vom Bösen zu scheiden? Und ich habe mich für die Sünde
entschieden, obwohl es mir selbst jetzt noch schwerfällt, sie auch
als das Böse zu erkennen. Nun, da ich das Alter spüre und die Kälte
des Todes, muss ich mein Gewissen erleichtern. Und auch, warum es
verschweigen, da ich fürchte, bald vor SEINEM Richterstuhl zu stehen.
Nun also werde ich aufschreiben, wie es dazu kam, dass ich fehlte. Wie die
gute Stadt Paris unterging und mit ihr das Abendland. Wie Eltern ihre
Kinder und Kinder ihre Eltern verließen, wie Ärzte die ihnen
anvertrauten Kranken im Stich ließen und wie — die Feder sträubt
sich, dies niederzuschreiben — selbst Mönche, Priester, Männer
des HERRN Sterbende in ihrer Not allein ließen.
Und wie sich, fast unbemerkt
inmitten dieses Wütens der apokalyptischen Reiter, verschwiegene, gefährliche
Männer zu einer Verschwörung vereinten. Einer Verschwörung,
so gewaltig, dass sie über Jahrhunderte wirken wird, ja vielleicht für
alle Zeiten. Jeden Tag bete ich zum HERRN, dass er den Verschwörern
Einhalt gebieten möge. Dann wieder überfällt mich in düsteren
Stunden der Zweifel und Bangigkeit schleicht sich in mein Herz. Und wenn
die Verschwörer nun nicht Kreaturen Satans sind, sondern doch
Werkzeuge des HERRN? Wenn nun ich in meiner Schwäche nicht mehr
erkennen kann, was gut ist und was böse?
Oh, wie gerne würde ich
beichten! Wie gerne würde ich meine Seele öffnen! Und wie sehne
ich mich danach, auf einer harten Bank zu knien und irgendwann aus dem
dunklen Beichtstuhl die erlösenden Worte zu hören: Deinde ego te absolvo.
Doch gebeichtet habe ich
nicht mehr seit vier Jahrzehnten, obwohl ich allen Nachbarn als guter
Christ und Kirchgänger gelte. Mein Wissen und meine Erinnerungen,
meine Sünden und meine Qualen bedrücken mich. Statt einem Diener
des HERRN werde ich mich nun dem Pergament zur Beichte anvertrauen.
Es ist August, der Monat der
Ernte. Es dunkelt schon, die Öllampe flackert und rußt im
feuchten Hauch, der vom Ozean herüberweht. Meine Frau ruht, meine
Kinder und Enkel schlafen den Schlaf der Gerechten.
Ich muss die geschliffenen Gläser,
die Jorge letztes Jahr aus Venedig mitgebracht hat, vor die Augen halten,
um die Zeichen klar zu sehen, die ich schon auf das Pergament geworfen
habe. Vor vierzig Jahren bedurfte ich dieser kunstvoll geschliffenen Gläser
noch nicht. Da waren meine Augen scharf wie die eines Falken. Und doch
sahen sie die Zeichen nicht, obwohl sie übergroß geschrieben
waren. Nun will ich berichten von jenem Jahr des HERRN, 1348, da die
Weitere Kostenlose Bücher