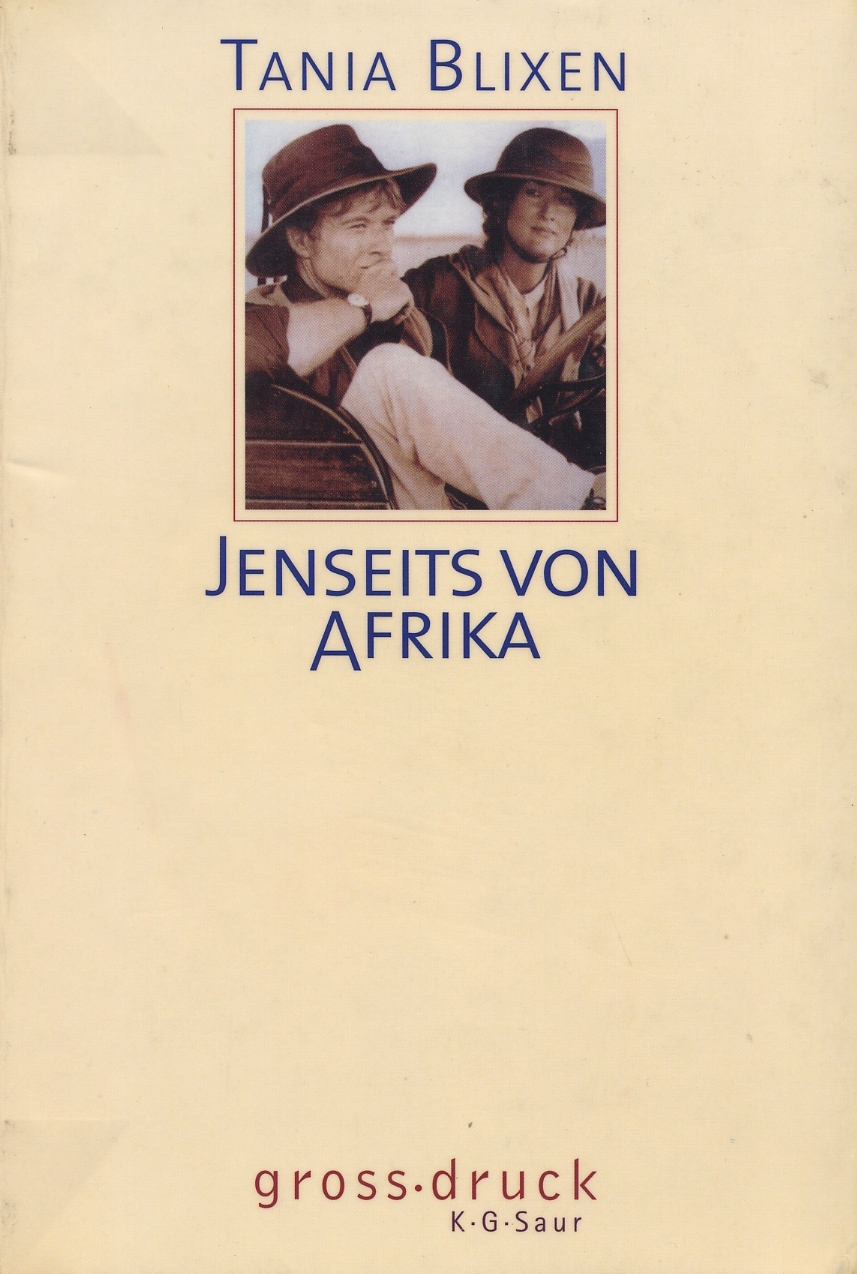![Jenseits von Afrika]()
Jenseits von Afrika
zermalmten.
Viel kann ich nicht davon erzählen. Einmal, weil es verborgene Mächte seines Inneren waren, und dann, weil inzwischen für mich selbst Ereignisse eintraten, die meine Gedanken von Kaninu und seinem Schicksal abwandten und alles, was die Farm betraf, für mich in Dunst hüllten wie den fernen Gipfel des Kilimandscharo, den ich zuweilen von der Farm aus sehen konnte und zuweilen nicht. Die Schwarzen nahmen solche Zeiten der Geistesabwesenheit geduldig hin, als wäre ich wirklich aus ihrem Dasein in eine andere Sphäre entrückt, und sprachen hinterher so, als wäre ich inzwischen fort gewesen. »Der große Baum fiel um«, sagten sie, »mein Kind starb, während du bei den Weißen warst.«
Als Wanyangerri so weit genesen war, daß er das Hospital verlassen konnte, holte ich ihn auf die Farm zurück und sah ihn dann nur noch gelegentlich bei einer Ngoma oder auf der Weide.
Einige Tage nach seiner Rückkehr stellten sich sein Vater Wainaina und seine Großmutter vor meinem Hause ein. Wainaina war ein kleiner rundlicher Mann, eine Seltenheit unter den Kikuju, die fast durchwegs schlanke Leute sind. Er trug ein schütteres Bärtchen und hatte zudem noch die Eigenheit, daß er einem nicht gerade ins Gesicht sehen konnte. Er machte den Eindruck eines geistigen Troglodyten, der in Frieden gelassen sein will. Mit ihm kam seine Mutter, ein uraltes Kikujuweib.
Die schwarzen Frauen scheren sich den Kopf, und es ist merkwürdig, wie bald man selbst findet, daß diese kleinen runden, sauberen Schädel, die wie eine Art dunkler Nüsse aussehen, der einzig richtige Ausdruck des Fraulichen sind und daß ein Haarschopf auf dem Kopf einer Frau ebenso unweiblich ist wie ein Bart. Wainainas alte Mutter hatte die kleinen Büschel weißer Haare auf ihrem runzeligen Skalp wachsen lassen und erweckte dadurch, wie ein unrasierter Mann, den Eindruck der Verwahrlosung oder Schamlosigkeit. Sie lehnte sich auf ihren Stock und ließ Wainaina das Wort führen, aber ihr Schweigen hatte etwas Funkensprühendes, als wäre sie geladen mit einem zehrenden Lebensfeuer, von dem sie ihrem Sohn nichts abgegeben hatte.
Das Geschäft, um dessentwillen sie zu meinem Hause geschlurft kamen, war friedfertiger Natur. Wanyangerri, so erzählte der Vater, könne keinen Mais essen und sie seien arme Leute und hätten wenig Mehl und keine Milchkuh. Ich möchte ihnen doch, bis der Fall Wanyangerri geklärt sei, von meinen Kühen etwas Milch geben. Sonst wüßten sie nicht, wie sie das Kind am Leben erhalten sollten, bis der Schadenersatz geleistet sei.
Farah war an dem Tage wegen einer seiner Familienzwistigkeiten in Nairobi. In seiner Abwesenheit stimmte ich zu, daß Wanyangerri täglich etwas Milch von meiner Kuhherde erhalten sollte, und gab meinen Hausboys – die sich merkwürdig störrisch oder verlegen zeigten – Anweisung, sie jeden Morgen abholen zu lassen.
Darüber vergingen zwei oder drei Wochen, da erschien eines Abends Kaninu bei mir. Er stand unversehens im Zimmer, wo ich nach Tisch lesend am Feuer saß. Da die Schwarzen gemeinhin eine Aussprache im Freien vorziehen, war ich nach der Art, wie die Tür hinter meinem Rücken geschlossen wurde, auf eine überraschende Mitteilung gefaßt. Aber die erste Überraschung war die, daß Kaninu stumm blieb. Der große alte Kikuju sah sehr krank aus, er hing auf seinem Stock, sein Mantel schien keinen Leib zu bergen, seine Augen waren matt wie die Augen eines Toten, und er feuchtete unablässig die Lippen mit der Zunge an.
Als er schließlich zu sprechen begann, verkündete er nur langsam und verdrossen, er glaube, es stehe sehr schlimm. Nach einer Weile ließ er, als wäre es nicht der Rede wert, die Bemerkung fallen, er habe jetzt Wainaina zehn Schafe bezahlt. Und nun, fuhr er fort, verlange Wainaina von ihm auch noch eine Kuh und ein Kalb, und er werde sie ihm geben. Warum er das denn getan habe, fragte ich, da doch noch kein Urteil ergangen sei. Kaninu antwortete nicht, er sah mich nicht einmal an. Er war an diesem Abend der Wanderer oder Pilger, der keine bleibende Statt hat. Er war nur im Vorbeigehen hereingetreten, um mir zu berichten, und hatte es eilig, wieder fortzukommen. Ich konnte mir nur denken, daß er krank war, und sagte nach einer Pause, ich wolle ihn anderntags ins Hospital fahren. Da warf er mir einen kurzen, gequälten Blick zu: der alte Spötter mußte sich bitter verspotten lassen. Aber ehe er ging, tat er noch etwas Sonderbares: er hob die Hand zum Gesicht, als wische er
Weitere Kostenlose Bücher