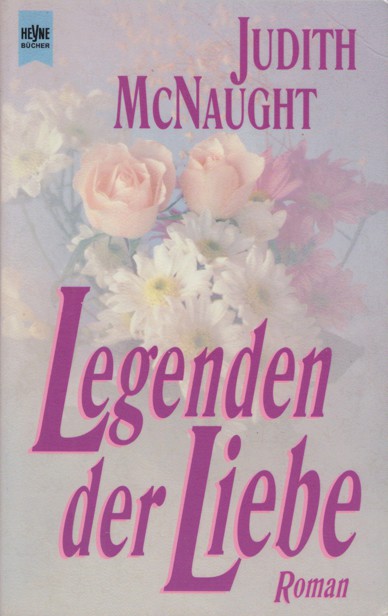![Judith McNaught]()
Judith McNaught
zurechtwies:
»Sie impertinenter Fratz, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein bißchen mehr
Respekt erweisen würden.«
Ohne jedes Zeichen von Reue und
Bußfertigkeit legte sie den Kopf schräg und fragte neugierig: »Weil Sie ein
Earl sind?«
»Nein, weil ich größer bin als Sie.«
Ihr Lachen ertönte glockenhell und
wirkte so ansteckend, daß Stephens Gesicht vor lauter Anstrengung, eine gleichgültige
Miene zur Schau zu stellen, schmerzte.
»Da wir jetzt festgehalten haben,
daß ich impertinent bin und Sie größer sind als ich«, sagte sie mit einem
fröhlichen, unschuldigen Blick, »darf ich dann korrekterweise auch annehmen,
daß Sie älter sind als ich?«
Stephen nickte, weil er seiner
Stimme nicht traute.
Sofort hakte sie nach. »Um wie viele
Jahre?«
»Hartnäckiges kleines Ding«, sagte
er, schwankend zwischen Erheiterung und Bewunderung dafür, wie geschickt sie
das Thema wieder auf ihre Fragen gebracht hatte.
Sie musterte ihn nun ernst. Ihre
grauen Augen zogen ihn magisch an. »Sagen Sie mir bitte, wie alt ich bin. Sagen
Sie mir, wie mein zweiter Vorname lautet. Oder wissen Sie es nicht?«
Er wußte es natürlich nicht.
Andererseits kannte er auch das Alter oder den zweiten Vornamen vieler anderer
Frauen nicht, die mit ihm das Bett geteilt hatten. Da sie wohl nur wenig Zeit
mit ihrem Verlobten verbracht hatte, schien es ihm am sichersten und auch am
vernünftigsten, ihr die Wahrheit zu sagen. »Eigentlich haben wir über keines
dieser Themen je gesprochen.«
»Und meine Familie – wie ist sie?«
»Ihr Vater ist Witwer«, sagte
Stephen, der sich an das erinnerte, was er von Burletons Butler erfahren
hatte. Dieses Thema konnte er endlich bewältigen. »Sie sind sein einziges
Kind.«
Sie nickte, dachte darüber nach und
lächelte ihn an. »Wie haben wir uns kennengelernt?«
»Ich denke, Ihre Mutter hat Sie ihm
kurz nach Ihrer Geburt vorgestellt.«
Sie lachte, weil sie dachte, er
hätte nur einen Witz gemacht. Er runzelte die Stirn, weil er Fragen wie diese
nicht vorausgesehen hatte. Er konnte sie weder beantworten noch umgehen, und
ganz gleich, was er tat oder sagte, er war und blieb ein Betrüger.
»Ich meine, wie haben wir beiden uns
kennengelernt?«
»Auf die übliche Art«, antwortete er
ausweichend.
»Und die wäre?«
»Wir wurden einander vorgestellt.«
Er stand auf, um den verwirrten, prüfenden Blick in ihren großen grauen Augen
nicht mehr ertragen zu müssen, und ging hinüber zur Anrichte, auf der er eine
Karaffe hatte stehen sehen.
»Mylord?«
Er blickte über die Schulter,
während er den Stöpsel aus der Karaffe zog und sie zum Einschenken hob. »Ja?«
»Lieben wir uns sehr?«
Der halbe Brandy rann ihm über den
Daumen am Glas vorbei auf das goldene Tablett. Er fluchte im stillen, weil er
sich bewußt machte, daß sie sich, ganz gleich, was er jetzt erwiderte, immer
betrogen fühlen würde, sobald sie ihr Gedächtnis wiedererlangte. Wegen der
Lügen und der Tatsache, daß er auch noch den Tod des Mannes, den sie liebte,
verschuldet hatte, würde sie ihn hassen, wenn erst einmal alles aufgekommen
war. Allerdings nicht so sehr, wie er sich selbst haßte, vor allem für das, was
er jetzt gleich tun würde. Er schüttete den Schluck Brandy, der schließlich im
Glas gelandet war, in einem Zug herunter, dann drehte er sich um und sah sie
an. Er hatte keine Wahl, deshalb gab er ihr eine Antwort, die die gute
Meinung, die sie von ihm hatte, notwendigerweise zerstören würde. »Wir sind
hier in England, nicht in Amerika ...«, begann er.
»Ja, ich weiß. Dr. Whitticomb hat es
mir gesagt.«
Innerlich wand sich Stephen bei dem
Gedanken, daß man ihr sogar sagen mußte, in welchem Land sie sich befand. Auch
dafür trug er die Schuld. »Wir sind hier in England«, wiederholte er schroff.
»In England heiraten die Paare der Oberschicht aus vielerlei Gründen, und die
meisten davon sind praktischer Natur. Anders als in Amerika gilt es hier nicht
als angebracht oder wünschenswert, seine Gefühle zur Schau zu tragen, und wir
reden auch nicht ständig über dieses zarte Gefühl, das man Liebe nennt. Das
überlassen wir den Bauern und den Dichtern.«
Sie sah ihn an, als hätte er ihr
eine Ohrfeige gegeben, und Stephen stellte sein Glas heftiger ab als
beabsichtigt. »Ich hoffe, ich habe Sie mit meiner Offenheit nicht verärgert«,
sagte er, wobei er sich vorkam wie ein Schuft. »Es ist spät, und Sie brauchen
Ruhe.«
Er verbeugte sich knapp, um
anzudeuten, daß das Gespräch
Weitere Kostenlose Bücher