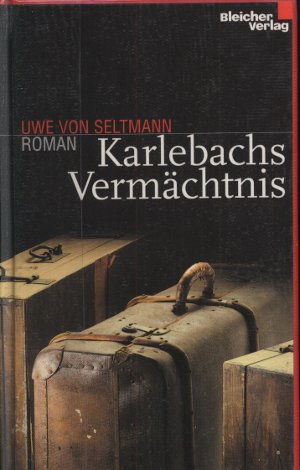![Karlebachs Vermaechtnis]()
Karlebachs Vermaechtnis
nicht anwesend sein konnte, der andere für ihn unterschreiben sollte. Das war über einige Semester gut gegangen, denn unsere Unterschriften ähnelten sich verblüffend. In der letzten Zeit war der Herr Kaiser jedoch sehr unzuverlässig geworden und mehrmals nicht zum Seminar erschienen, obwohl ich meinerseits mein Fernbleiben ausdrücklich angekündigt hatte.
Ich war enttäuscht, dass ich immer noch nichts über das schreckliche Geschehen beim Judenhaus herausgefunden hatte. Was hatte Opa Bernhard so belastet, dass er nie darüber sprach? Ich hatte ihn als ehrlichen und vertrauenswürdigen Menschen geschätzt, seinen Rat gesucht und seine Hilfe bekommen. Wenn ich für jemanden die Hand ins Feuer legen würde, dann für ihn. Gewiss, als freier Mitarbeiter der Lokalpost hatte ich rasch bemerkt, dass sich hinter der Fassade eines Biedermannes tiefe Abgründe auftun können. Und wenn ich eines in meinem Studium gelernt hatte, dann dies, dass der Mensch von Grund auf nicht gut, sondern böse ist. Aber dass Opa Bernhard eine Leiche im Keller hatte? Nein, das konnte und wollte ich nicht glauben. Also musste ich herausfinden, was er mir vor seinem Tod mitteilen wollte. Hatte er die Vertreibung der jüdischen Familien gemeint? Die lag allerdings schon so lange zurück, dass kaum noch jemand der Beteiligten lebte. Den Abriss konnte er auch nicht meinen, denn der war allgemein bekannt. Alle Personen, die Onkel Alfred erwähnt hatte, waren tot, die Juden, der alte Pietsch, der alte Frick, die alte Hexe. Wer waren also die beiden Männer, die Opa Bernhard erwähnt hatte? Was wollte er mit dem Sprichwort sagen »Unrecht Gut darf nicht gedeihen«? Die Juwelen der Karlebachs kamen mir in den Sinn, aber ich verwarf diesen Gedanken wieder. Die Nazis hatten bestimmt jeden Winkel des Hauses durchsucht, jeden Zentimeter des Gartens umgegraben. Es war kein Geheimnis, dass Juden in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ihre Wertsachen irgendwo versteckten, bevor sie abtransportiert wurden. Pietsch war an jenem Dienstagabend besonders gut gelaunt. Er hieß mich freundlich willkommen, legte mir jovial die Hand auf die Schulter und prophezeite mir eine große Karriere als Journalist. »Aber bau erstmal dein Examen«, mahnte er noch und wandte sich dann der jungen und gut aussehenden Kollegin eines Nachrichtenmagazins zu, die aus der Landeshauptstadt in die Provinz gereist war. Das Büfett bot einen ausgezeichneten Eindruck: Lachsbrötchen, Geschnetzeltes in Rahmsauce, diverse Vor- und Nachspeisen, dazu die passenden, vor allem alkoholischen Getränke. Als auch Chefredakteur Stumpf erschien, der die Gesprächsrunde leiten sollte, erschien, bat Pietsch um Ruhe und nannte die Punkte, zu denen er gerne befragt werden wollte. Außerdem erwarte er noch einen sehr charmanten und liebenswürdigen Gast, der ein Projekt vorstellen wolle, in das er, Pietsch, außerordentlich viel Zeit und Geld investiert habe.
Der Abend plätscherte dahin, einige besonders Eifrige taten sich hervor, andere, darunter auch ich, malten Häuschen und Kringel in ihre Blöcke. Plötzlich, als der schwere Wein bei mir für eine angenehme Müdigkeit sorgte, klopfte es. In Sekunden saß ich kerzengerade, ich traute meinen Augen nicht: Simona Zorbas!
Pietsch stellte sie uns mit blumigen Worten vor. Obwohl noch jung an Jahren sei sie zur neuen Abteilungsleiterin im städtischen Heimatmuseum berufen worden. Er habe potente Sponsoren in der Wirtschaft aufgetan, damit das Heimatmuseum eine eigene Abteilung zur Erforschung der regionalen Industriegeschichte erhalte. Einige klatschten, ich war etwas enttäuscht.
Pietsch erteilte Simona Zorbas das Wort, die sogleich in sachlichem Ton, der in meinen Augen nicht zu ihrem aparten Äußeren paßte, das Vorhaben darstellte. In der Fragerunde meldete ich mich als Erster. Was sie denn dazu gebracht habe, sich ausgerechnet auf Industriegeschichte zu spezialisieren, wollte ich wissen. »Gute Frage«, sagte Simona Zorbas und lächelte mir zu. Ich bekam rote Ohren und kaum mit, was sie sagte, denn sie schaute mich bei ihrer Antwort unverwandt an. Ich rätselte, wie ich ihr Lächeln und ihren Blick deuten sollte. Später, als der offizielle Teil endlich beendet war und man sich am Büfett bediente, sprach ich sie an. »Der Leserbriefschreiber«, begrüßte sie mich süffisant lächelnd.
Die Worte, die ich mir zurecht gelegt hatte, waren mir entfallen und meine Ohren wurden wieder feuerrot, obwohl ich es unbedingt vermeiden wollte. So nahm
Weitere Kostenlose Bücher