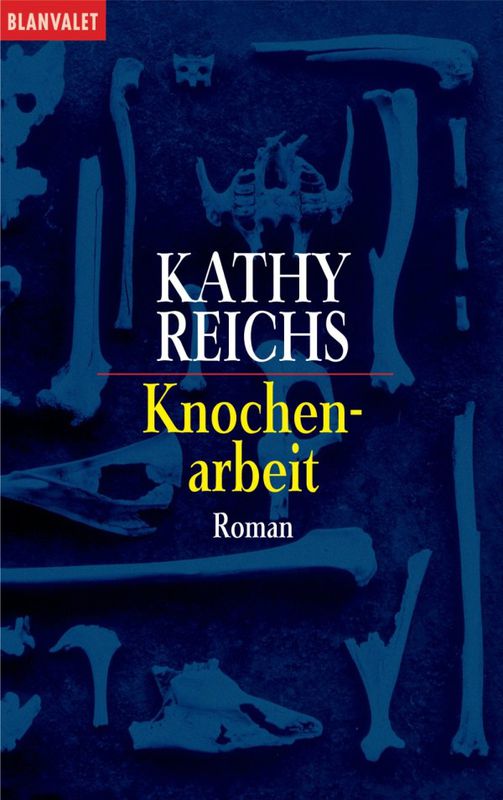![Knochenarbeit: 2. Fall mit Tempe Brennan]()
Knochenarbeit: 2. Fall mit Tempe Brennan
mit meinen Büchern und Papieren auf die Couch.
Anfangs las ich weiter in den Bélanger-Tagebüchern, doch nach zwanzig Seiten legte ich sie weg und griff zu dem Buch über die Pockenepidemie. Es war so faszinierend wie Louis-Philippe langweilig.
Ich las von Straßen, durch die ich jeden Tag gehe. In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatten Montreal und die Dörfer der Umgebung über zweihunderttausend Einwohner. Der Stadtkern erstreckte sich von der Sherbrooke Street im Norden am Fluß entlang zum Hafen im Süden. Im Osten war Montreal begrenzt von der Industriestadt Hochelega und im Westen von den Arbeiterdörfern Ste. Cunégonde und St. Henri, die knapp oberhalb des Lachine-Kanals lagen. Im letzten Sommer war ich den gesamten Radweg am Kanal entlanggefahren.
Damals wie heute hatte es Spannungen gegeben. Obwohl der Großteil Montreals westlich der Rue St. Laurent englischsprachig war, hatten die Franzosen zu dieser Zeit bereits in der Stadt als Ganzes die Mehrheit. Sie beherrschten die Stadtpolitik, die Engländer dagegen den Handel und die Presse.
Die Franzosen und die Iren waren katholisch, die Engländer Protestanten. Größtenteils waren die Gruppen getrennt geblieben, im Leben wie im Tod; jede hatte hoch oben auf dem Berg ihren eigenen Friedhof gehabt.
Noch heute sind Sprache und Religion in Montreal sehr bestimmend. Die katholische Schulbehörde. Die protestantische Schulbehörde. Die Nationalisten. Die Föderalisten. Ich fragte mich, welcher Seite Élisabeth Nicolet sich zugerechnet hatte.
Es wurde dunkel im Zimmer, draußen gingen die Straßenlampen an. Ich las weiter.
Im späten neunzehnten Jahrhundert war Montreal ein bedeutendes Handelszentrum mit einem großartigen Hafen gewesen, mit riesigen steinernen Lagerhäusern, Gerbereien, Seifensiedereien und Fabriken. Die McGill war damals bereits eine führende Universität. Aber wie andere viktorianische Städte war auch sie ein Ort der Kontraste gewesen, wo die Paläste der Handelsfürsten die Hütten des Lumpenproletariats überschatteten. Gleich neben den breiten, gepflasterten Prachtstraßen, hinter Sherbrooke und Dorchester, lagen Hunderte von Feldwegen und ungepflasterten Gassen.
Die Kanalisation der Stadt war ungenügend, auf Freiflächen verrotteten Abfälle und Tierkadaver, und überall lagen Exkremente. Der Fluß wurde als offener Abwasserkanal benutzt. Was im Winter der Frost bedeckte, verfaulte und stank in den wärmeren Monaten. Jedermann klagte über die üblen Gerüche.
Mein Tee war kalt geworden, und so stand ich auf, streckte mich und brühte mir eine neue Tasse auf. Als ich das Buch wieder aufschlug, blätterte ich zu dem Kapitel über Hygiene. Über die ungenügenden sanitären Verhältnisse im Hôtel-Dieu-Krankenhaus hatte sich Louis-Philippe in seinem Tagebuch immer wieder beklagt. Und natürlich wurde der alte Knabe in dem Kapitel erwähnt. Er hatte sich in den Gesundheitsausschuß des Stadtrats wählen lassen.
Ich las einen faszinierenden Bericht über eine Ratsdiskussion zum Thema menschliche Ausscheidungen. Einige Montrealer spülten ihre Exkremente in städtische Abwasserrohre, die direkt in den Fluß führten. Andere benutzten Trockenklosetts, wobei sie Erde über ihre Exkremente streuten und sie dann der Müllabfuhr zur Entsorgung überließen. Und wieder andere entleerten sich in primitive Plumpsklos.
Der Gesundheitsbeauftragte der Stadt berichtete, daß die Bewohner ungefähr einhundertsiebzig Tonnen Fäkalien pro Tag produzierten, über zweihundertfünfzehntausend Tonnen pro Jahr. Er warnte, daß die zehntausend Plumpsklos und Senkgruben der Stadt die Hauptursache für Infektionskrankheiten wie Typhus, Scharlach und Diphtherie seien. Schließlich hatte sich der Stadtrat für ein System der Fäkaliensammlung und -Verbrennung entschieden. Louis-Philippe stimmte dafür. Das war am 28. Januar 1885.
Am Tag nach der Abstimmung fuhr der Westzug der Grand Trunk Railway in die Station Bonaventure ein. Ein Schaffner war krank, der Eisenbahnarzt wurde gerufen. Bei der Untersuchung des Mannes wurde eine Pockeninfektion festgestellt. Da er Protestant war, brachte man ihn ins Montreal General Hospital, doch dort wurde ihm die Aufnahme verweigert. Immerhin gestattete man dem Patienten, in einem Isolierzimmer auf der Infektionsstation zu warten. Schließlich nahm man ihn, auf Bitten des Eisenbahnarztes, widerwillig im katholischen Hôtel Dieu auf.
Ich stand auf, um das Feuer zu schüren. Während ich die Scheite
Weitere Kostenlose Bücher