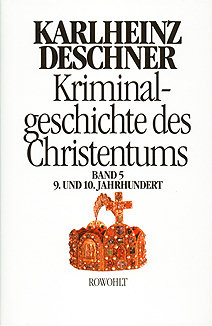![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
im 20. Jahrhundert im Kölner »Domschatz« gezeigt! – entbrannte zwischen dem Kölner und dem Trierer Metropoliten ein dreißigjähriger Machtkampf. Hing doch die Würde eines Bischofssitzes und seine – in der Religion der Demut so wichtige – Vorrangstellung gegenüber einem anderen Bistum wesentlich davon ab, inwieweit sich seine Gründung auf Petrus oder einen Petrusschüler zurückführen ließ, wovon selbstverständlich keine Rede sein kann (vgl. II 56 ff.).
Metz und Trier erhoben also Anspruch auf die (erst im 9. Jahrhundert schriftlich fixierte) »Petrusjüngerschaft«! Und gegen die erdrückende Übermacht, die Brun von Köln gewann, bot man die angebliche apostolische Sukzession des Trierer Stuhls auf und stützte sie durch das Petrusstabmärchen, worin alles erfunden ist; nicht zuletzt die Totenerweckung des Kölner Oberhirten Maternus – er selbst zwar im 4. Jahrhundert historisch bezeugt, doch schon vom Apostel Petrus ausgesandt zur Mission! Bei seinem plötzlichen Tod holte man Petri Stab aus Rom, und mit dessen wunderbarer Hilfe wurde der schon vierzig Tage im Elsaß begrabene Maternus wieder lebendig und dann Bischof von Trier.
Ein weiteres Mal steht übrigens der – wer könnte es ihm verdenken – anscheinend gern lebende Bischof zur Zeit Karls »des Großen« für neun Jahre von den Toten auf. Und sollte, wie christliche Chronisten auch wissen, der hl. Maternus (gut gegen Infekte und Fieber; Fest 14. September) sogar ein Verwandter Jesu gewesen sein, nämlich der bekannte Jüngling von Nain, so wäre Maternus immerhin dreimal gestorben und wieder und wieder auferstanden – wenn seine Totenerweckung in der Bibel auch nur Lukas berichtet, alle anderen Evangelisten, die doch so viele kleinere Mirakel Jesu erwähnen, aber darüber schweigen. Nebenbei: 1059 begründete auch der Reimser Metropolit seine Rechte auf Primat und Königskrönung mit Berufung auf den Petrusstab, den einst Papst Hormisdas Bischof Remigius von Reims verliehen habe!
Brun von Köln bemächtigte sich also, vermutlich 953, des im Metzer Dom befindlichen ominösen Stabes, um das Trierer Primatstreben zu entkräften. Doch fälschte man in den sechziger Jahren des 10. Jahrhunderts, wohl im Trierer Domklerus, das sogenannte Silvesterdiplom, wonach Papst Silvester I. (314–335) der Trierer Kirche jene Primatsrechte über die gallischen und germanischen Bistümer bestätigt, die ihr einst Petrus selber verliehen! Und aufgrund dieses Schwindels erkannte dann Papst Johann XIII. am 22. Januar 969 dem Trierer Erzbischof Theoderich (965–977) den begehrten Primat über Gallien und Germanien zu.
Leider befand sich nun aber der so wichtige »Petrusstab« in Köln. Doch gelang es dem Trierer Erzbischof Egbert (977–993), einem in der königlichen Hofkapelle geschulten hochgebildeten Kopf, der 976 Kanzler Ottos II. wurde, vom Kölner Erzbischof Warin (975–985) – der vielleicht unter der Last der »historischen Beweise« Triers zusammenbrach – die Einwilligung zu einer Teilung des Stabes durchzusetzen. Nach christlicher Anschauung war ja jede Teilreliquie so gut wie eine ganze, da auch in der geteilten die Heilswirkung der ganzen steckte. Erzbischof Egbert, ebenso auf die materielle Sicherung seines Sprengeis bedacht wie auf den Primatsanspruch Triers über Gallien und Germanien, ließ speziell zu seinem Fragment noch einen äußerst preziösen Knauf anfertigen, wodurch das Kölner »Original« schließlich beträchtlich übertroffen und der Trierer Petrusstab zu einem der Meisterwerke »ottonischer Goldschmiedekunst« wurde (Achter).
Nicht genug. Eine ausführliche Inschrift der Kostbarkeit erzählt die Geschichte des Stabes, wonach dieser einst vom hl. Petrus »zur Auferweckung des Maternus von ihm (Petrus) selbst übersandt« worden sei und rügte dazu noch mild die Aneignung alten Trierer Kirchenguts durch Erzbischof Brun von Köln, der den Stab »abgefordert« habe. »Die Schriftquellen lassen den Kampf, den Trier seit der Jahrhundertmitte um Primat und Stab führt, in aller Schärfe deutlich werden. Je mehr Trier aus der Reihe der deutschen Erzbistümer herausgedrängt zu werden drohte, desto intensiver wird das Bestreben, durch Demonstration des eigenen Alters und des apostolischen Auftrags die Rivalen auszustechen« (Achter). 20
Nach der Unterwerfung der liudolfingischen Empörer glückte Otto I. noch ein weiterer und größerer Machtgewinn, der Sieg auf dem Lechfeld über die Ungarn. (Eine Niederlage hätte ihn
Weitere Kostenlose Bücher