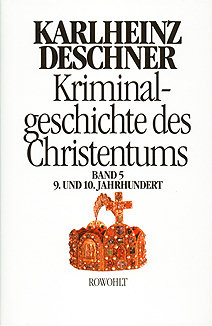![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Weg nach Augsburg, brachte das unrechte Gut zurück und bat den Bischof, er möge ihn im Namen Christi mit Ruten züchtigen und ihm Vergebung seiner Schuld gewähren. Und so wurde er vom Teufel befreit und kehrte geheilt nach Hause zurück.« Ja, sie wußten mit Schafen umzugehn.
Als es derart die Schäden zu überwinden, den Aufbau zu bewerkstelligen galt, förderte Ulrich natürlich »besonders«, betont Dompropst Gerhard, die »ausgeplünderten Domgeistlichen«, »unterstützte sie in jeder Weise«. Und nicht zuletzt unterstützte er auch sich, befahl er, seine eigenen Güter, die niedergebrannt und trostlos dalagen, »durch emsige Arbeit auf den Feldern und an den Gebäuden wieder in die Höhe zu bringen. Die wackere Schar seiner Hörigen ging gehorsam an die Arbeit und erbrachte nach entsprechender Zeit für den nötigen Bedarf, was immer möglich war.« Was immer möglich war – steht das schon in einem Heiligentraktätchen! Ja, sie wußten, mit Schafen umzuspringen, zumal mit hörigen Schafen.
Insbesondere aber leitete Ulrich 955 heroisch die Verteidigung Augsburgs, bis Ottos Kriegsvolk nahte und der hl. Bischof seine eigenen Truppen in die Schlacht warf. Zwar predigte und mahnte er: »Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern mit Segen; Verfolgung um der Gerechtigkeit willen geduldig zu ertragen«. Doch es gehörte auch zu seinen Prinzipien, alle Menschen zu lieben, »alle Menschen guten Willens, von denen der Chor der Engel singt: ›Und auf Erden Friede den Menschen, die guten Willens sind‹, den Bösen aber in allem ihrem schlechten Tun zu widerstehen, gemäß den Worten des heiligen Propheten David: ›Zu nichts geworden ist vor seinem Angesicht der Böse ...‹«
Nach Ulrichs Biographem ließ der Bischof zwar nur seine Streitmacht (milites) »mannhaft vor dem Tore kämpfen« und saß dabei dahinter »auf seinem Roß (super caballum), angetan mit der Stola, ohne durch Schild, Harnisch und Helm geschützt zu sein«. Doch vermutet die Forschung, daß Ulrich, der nicht nur häufig in der Umgebung des Königs geweilt (nachweislich fünfzehnmal), sondern selbst monatelang in seinem Heer »mitgewirkt« hat (Weitlauff), auch schlachtend auf dem Lechfeld teilnahm. Nicht anders als sein eigener Bruder Dietbald und sein Neffe Reginbald, die beide im Gemetzel fielen. Nicht anders als Bischof Michael von Regensburg (gest. 972), dem man im Kampfgetümmel ein Ohr abschlug; sichtlich beschützt, von ihm selber bezeugt, durch den hl. Emmeram – deshalb so bemerkenswert, weil auch Bischof Michael zu jenen Regensburger Kirchenfürsten zählte, die sich an Emmerams Schätzen vergriffen! 27
Die Hagiographie möchte den Heiligen, der doch »eine führende Rolle in der Ungarnschlacht« spielte (Bosl), freilich weniger blutbesudelt sehen.
Die Lebensbeschreibung »des heiligsten unter allen Menschen jener Zeit« (Mönch Ekkehard IV.), von dem jüngeren, zu seiner engsten Umgebung zählenden Gerhard zwischen 983 und 993 schon »zum Zweck der Heiligsprechung« verfaßt (Lexikon für Theologie und Kirche), und auch deshalb bereits mit vielen Wundererzählungen, Visionen, Prophezeiungen und sicher falschen Nachrichten versehen, wurde bald darauf in Rom vorgelegt. Und am 31. Januar 993 hat auf einer Lateransynode Papst Johann XV. – selbst durch einen Nepotismus »schlimmster Form« und seine »krankhafte Geldgier« (Katholik Kühner) beim Volk wie beim eigenen Klerus verhaßt – Ulrich, diesen dem Nepotismus huldigenden bischöflichen Sklavenhalter und Krieger, der indes auch dreimal »wallfahrend« in Rom und überhaupt »ein Juwel unter den Priestern« (Thietmar) gewesen ist, als ersten Katholiken förmlich und feierlich kanonisiert.
»Patron gegen Ratten und Mäuse«, »die Gefahr aus dem Osten« und die 29 Nummern der »heiligen Gebeine«
Von nun an wurde sein Kult mächtig vorangetrieben. Bischof Gebhard von Augsburg (996–1000) und Abt Berno von Reichenau (1008–1048) haben die inhaltlich wichtige, doch schlecht geschriebene erste Ulrich-Vita überarbeitet, bezeichnenderweise alles Historische weggelassen und mit Bibelzitaten, Schwulst, Mirakulösem nur so gespickt; Spätere haben all das noch vielfach interpoliert. Ulrichs Grabkapelle aber, worin Kaiser Heinrich II. auch Ottos III. Eingeweide beisetzen ließ, besuchten schon früh sogar ausländische Wallfahrer. Nach Ulrich wurden massenhaft Kirchen, Kapellen, Ortschaften benannt. Bereits im 10. und 11. Jahrhundert riß man sich um seine Reste; die
Weitere Kostenlose Bücher