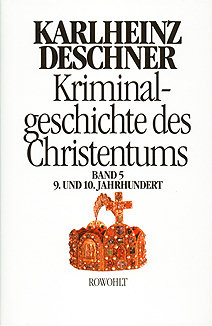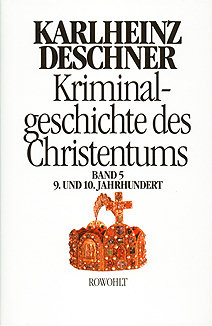
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Stiefbruder Alberichs II., verschwanden im Kerker und wurden nacheinander getötet. 58
Immerhin regierte nun Alberich II. (932–954), Marozias Sohn aus dem Geschlecht der Markgrafen von Spoleto, als »Fürst und Senator aller Römer« fast ein Vierteljahrhundert unbestritten und mit einer straffen Verwaltung in Rom wie dem Kirchenstaat und – beinahe – ohne expansive Ambitionen. Religiös gesinnt, persönlich fromm, beschenkte er zwar die Klöster, ordnete sich jedoch die Päpste völlig unter. Leo VII. (936–939), Stephan VIII. (939–942), Marinus II. (942–946) und Agapet II. (946–955) verdankten, nächst dem Hl. Geist, Alberich ihre Erhebung und erwiesen sich ihm gefügig. Nichts geschah ohne Befehl des Fürsten, übrigens auch ein besonderer Förderer der von Cluny ausgehenden Klosterreform – nicht zuletzt aus politischen und eigensüchtigen Gründen, um nämlich »die auf den Klostergütern hausenden Barone und seine eigenen, auf Klosterländereien sitzenden Dienstmannen, die ihm schließlich nur selbst gefährlich werden konnten, zu vertreiben« (Sackur). Bloß Stephan VIII. tanzte anscheinend aus der Reihe und soll im Herbst 942 nach der Teilnahme an einem Aufruhr gegen Alberich eingekerkert und derart verstümmelt worden sein, daß er starb. 59
König Hugos indes wiederholte Versuche, Rom zurückzuerobern, blieben vergeblich. Schon 932/933 und nochmals 936 stand er mit Heeresmacht vor der Stadt seiner Träume, und noch 939, 941 und 942 machte er mißglückende Vorstöße. »Jahr für Jahr«, schreibt Liutprand, bedrängte er Alberich, »verwüstete er alles, was er konnte, mit Feuer und Schwert und entriß ihm sämtliche Städte außer Rom«.
Dazwischen aber wehrte Hugo noch zwei weitere Interessenten ab, beide wahrscheinlich 933 während seines Kampfs um Rom: friedlich, doch durch Abtretung seiner niederburgundischen Herrschaftsrechte (nicht seiner Besitzungen), Rudolf II. von Hochburgund; und durch eine militärische Gegenaktion den Herzog Arnulf von Bayern, den Graf Milo sowie Bischof Rather von Verona herbeigerufen und »mit Freuden aufgenommen« hatten (Liutprand).
Berengar II. wird König von Italien
In Italien mußte König Hugo stets am meisten jene Geschlechter fürchten und bekämpfen, die er selbst am meisten gefördert, so daß sie schließlich dem kaum zu Unrecht chronisch Mißtrauischen, gelegentlich Grausamen, zu gefährlich schienen.
Dazu gehörte auch der Markgraf Berengar II., ein Enkel Kaiser Berengars I. (S. 324 f.), ein Anhänger Hugos und mit dessen Nichte Willa verheiratet. Doch nach der blutigen Liquidierung der tuscischen Dynastie beargwöhnte Hugo immer mehr den Einfluß des Hauses Ivrea: Berengar II. und seinen Halbbruder Anskar II. von Ivrea, Markgrafen von Spoleto-Camerino, deren Hausmacht sein eigenes, von den Alpen bis zum Prinzipat von Rom und Benevent sich erstreckendes Reich im Norden und Süden umklammerte. Deshalb betrieb er ihren Sturz, wobei Anskar umkam.
Aber Hugos Absicht, Berengar II. durch Blendung zu beseitigen, mißlang. Dabei hatte er doch bereits den Markgrafen Lambert von Toskana, seinen eigenen Halbbruder, durch das einfache Herausreißen der Augen – ein so beliebtes wie wirksames und gewiß gottgefälliges Regierungsinstrument so vieler christlicher Herrscher – erfolgreich ausgeschaltet. Indes wurde der neue Plan durch Hugos Sohn, den jungen König Lothar (benannt nach seinem Urgroßvater König Lothar II. S. 198 ff.), seit 931 Mitkönig, verraten; durch einen »schwachen« König, wie ihn Historiker inzwischen gern charakterisieren. Berengar, der Lothar ein Jahrzehnt später »Krone und Leben raubte«, floh wahrscheinlich im Herbst 941 zu Herzog Hermann von Schwaben, der ihn zu Otto I. weiterleitete. Anfangs 945 kehrte er jedoch zurück und eroberte mit Ottos Duldung Teile Norditaliens, wobei er die italienischen Großen durch Versprechungen von Lehen gewann, die er noch gar nicht besaß.
Vor allem der Klerus lief sogleich wieder zu ihm über.
Dem Priester Adelhard, der die das Etschtal beherrschende Feste Formicaria (Siegmundskron) befehligte, die Berengar passieren mußte, da alle übrigen Pässe in sarazenischer Hand waren, versprach er eidlich das Bistum Como. Adelhards Bischof Manasse, ein Verwandter König Hugos und von diesem mit den Bistümern Trient, Verona und Mantua beschenkt, sicherte er die Nachfolge im Erzbistum Mailand zu, worauf Manasse, berichtet Liutprand, alle Italiener aufforderte, Berengar beizustehen. Auch Bischof
Weitere Kostenlose Bücher