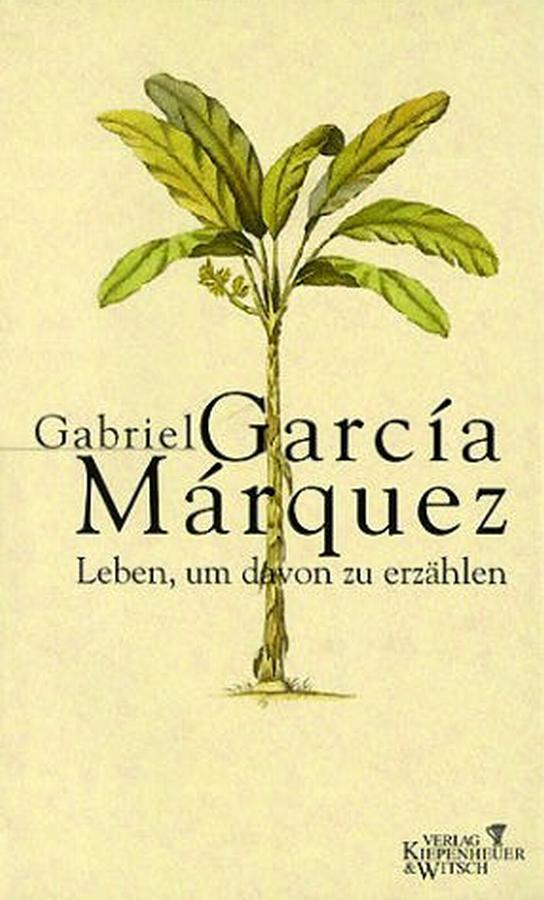![Leben, um davon zu erzählen]()
Leben, um davon zu erzählen
halbes Dutzend Studenten ließ sich in El Cisne häuslich nieder, um sich nach Einbruch der Nacht im gleißenden Licht der Tanzfläche auf die Schlussprüfungen vorzubereiten. Die Meeresbrise und das Tuten der Schiffe im Morgengrauen halfen uns über das Dröhnen der karibischen Blechmusik und das provozierende Verhalten der Nutten hinweg, wenn sie ohne Höschen in sehr weiten Röcken tanzten, die der Wind bis zur Taille hob. Ab und zu lud uns eins der Mädchen, die vielleicht Sehnsucht nach ihrem Papa hatte, mit dem bisschen Liebe, das ihr bei Morgengrauen noch übrig blieb, zum Schlafen ein. Eine von ihnen, an deren Namen und Maße ich mich genau erinnere, ließ sich von den Träumereien verführen, die ich ihr im Schlaf erzählte. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich Römisches Recht ohne Tricks bestand und mehreren Razzien der Polizei entging, als es verboten wurde, in den Anlagen zu schlafen. Wir verstanden uns wie in einer zweckmäßigen Ehe, nicht nur im Bett, sondern auch weil ich am frühen Morgen allerlei häusliche Dinge für sie erledigte, damit sie ein paar Stunden länger schlafen konnte.
Zu der Zeit hatte ich mich in der Zeitungsarbeit gut zurechtgefunden, die ich allerdings stets eher als literarische denn als journalistische Aufgabe betrachtete. Bogotá war ein Albtraum der Vergangenheit, über tausend Kilometer entfernt und mehr als zweitausend Meter über dem Meeresspiegel, und nur der Gestank der Asche vom 9. April war mir davon in der Erinnerung geblieben. Ich konnte mich immer noch für Kunst und Literatur entflammen, besonders bei den mitternächtlichen Runden, verlor aber allmählich etwas von meinem Enthusiasmus, Schriftsteller zu werden. Das ging so weit, dass ich nach den drei Erzählungen in El Espectador keine weitere mehr schrieb, bis Eduarde Zalamea mich Anfang Juli aufstöberte und mir durch Maestro Zabala ausrichten ließ, ich solle ihm nach sechsmonatigem Schweigen wieder eine Geschichte für seine Zeitung schicken. Angesichts der Person, von der die Bitte kam, nahm ich lose Gedankenfäden aus meinen Kladden wieder auf und schrieb Die andere Rippe des Todes, die nur wenig mehr als das Bisherige bot. Ich weiß noch genau, dass ich keine Vorstellung von einer Handlung hatte und mir diese erst beim Schreiben ausdachte. Die Geschichte wurde am 25. Juli 1948 wie die vorherigen in der Beilage »Fin de Semana« veröffentlicht, und bis zum neuen Jahr, als mein Leben schon ein anderes war, schrieb ich dann keine Erzählungen mehr. Es fehlte nur noch, dass ich die wenigen Juravorlesungen aufgab, in die ich ab und zu mal ging - das letzte Alibi, das die Träume meiner Eltern nährte.
Ich hätte kaum vermutet, dass ich schon bald ein sehr viel besserer Student als je zuvor sein würde, und zwar in der Bibliothek von Gustavo Ibarra Merlano, einem neuen Freund, den Zabala und Rojas Herazo mir enthusiastisch vorgestellt hatten. Er war gerade mit einem Diplom der Escuela Normal Superior aus Bogotá heimgekehrt und schloss sich sofort den Runden im El Universal und den Diskussionen im Morgengrauen auf dem Paseo de los Mártires an. Neben Héctors vulkanischer Rhetorik und Zabalas kreativem Skeptizismus hat mich Gustavo mit der strengen Systematik bekannt gemacht, die meinen improvisierten und diffusen Vorstellungen, aber auch meinem leichtsinnigen Herzen bitter Not tat. Und all das mit einer großen Zärtlichkeit und einem eisernen Charakter.
Schon am nächsten Tag lud er mich an den Strand von Marbella ins Haus seiner Eltern ein, dessen Hinterhof das unermessliche Meer war und das über eine Bibliothek verfügte, die sich über eine zwölf Meter lange Wand erstreckte und in der Gustavo nur Bücher verwahrte, die man lesen musste, um ohne Gewissensbisse leben zu können. Seine Ausgaben der griechischen, lateinischen und spanischen Klassiker befanden sich in so gutem Zustand, dass sie ungelesen wirkten, auf die Seitenränder waren jedoch weise Anmerkungen gekritzelt, manchmal in Latein. Gustavo machte solche Bemerkungen auch laut, errötete dabei aber bis zu den Haarwurzeln und versuchte das mit beißendem Humor zu überspielen. Bevor ich ihn kennen lernte, hatte ich von einem Freund gehört: »Der Kerl ist ein Priester.« Ich begriff schnell, weshalb man so etwas glauben konnte; es nicht zu glauben wurde aber fast unmöglich, wenn man ihn erst mal gut kannte.
Bei diesem ersten Mal redeten wir ohne Unterbrechung bis zum Morgengrauen, und ich stellte fest, dass er sehr vieles und
Weitere Kostenlose Bücher