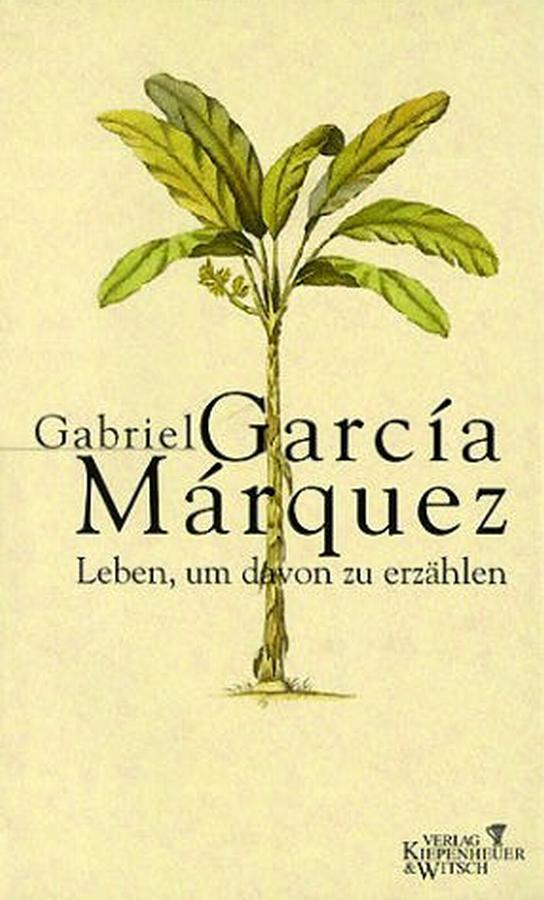![Leben, um davon zu erzählen]()
Leben, um davon zu erzählen
besser als die niedergeschriebene sein könnte und dass wir, ohne es zu wissen, dabei sind, eine neue Gattung zu erfinden, die der Literatur bereits zu fehlen scheint: die Fiktion der Fiktion.
Die nackte Wahrheit aber war, dass ich nicht wusste, wie ich weiterleben sollte. Meine Rekonvaleszenz in Sucre hatte mir zwar zu der Erkenntnis verholfen, dass ich nicht wusste, welchen Weg ich im Leben gehen sollte, mir aber keinen Hinweis darauf gegeben, welches Ziel ich ansteuern sollte, und mir auch nicht zu irgendeinem neuen Argument verholfen, mit dem ich meine Eltern davon überzeugen konnte, dass sie nicht zu sterben brauchten, wenn ich mir die Freiheit nahm, selbst über meine Zukunft zu entscheiden. Also machte ich mich mit zweihundert Pesos, die meine Mutter vor meiner Rückkehr nach Cartagena vom Haushaltsgeld für mich abgezweigt hatte, nach Barranquilla auf.
Am 15. Dezember 1949 betrat ich um fünf Uhr nachmittags die Librería Mundo in Barranquilla, um dort auf die Freunde zu warten, die ich seit jener Nacht im Mai, als ich mit dem unvergesslichen Serior Razzore in die Stadt gekommen war, nicht mehr gesehen hatte. Ich hatte nur eine Strandtasche mit einmal Wäsche zum Wechseln, ein paar Bücher und die Ledermappe mit meinen Entwürfen dabei. Ein paar Minuten später kamen sie alle, einer nach dem anderen, in die Buchhandlung.
Es gab eine lärmende Begrüßung, nur Álvaro Cepeda, der noch in New York war, fehlte. Als die Gruppe vollständig war, gingen wir zu den Aperitifs über, die nicht mehr neben der Buchhandlung im Café Colombia eingenommen wurden, sondern in einem neu eröffneten Lokal naher Bekannter auf der anderen Straßenseite: dem Café Japy.
Ich hatte kein Ziel, weder für diese Nacht noch für den Rest meines Lebens. Merkwürdig ist, dass ich nie auf den Gedanken gekommen war, dass dieses Ziel in Barranquilla liegen könnte, ich war nur dorthin gefahren, um über Literatur zu reden und persönlich für die Bücher zu danken, die sie mir nach Sucre geschickt hatten. Ersteres konnte ich mehr als genug, Letzteres gelang mir trotz mehrmaliger Versuche nicht, denn die Sitte, für etwas zu danken oder gedankt zu bekommen, löste innerhalb der Gruppe heiligen Schrecken aus.
Germán Vargas improvisierte an jenem Abend ein Essen für zwölf Personen, bunt zusammengewürfelt, Journalisten, Maler, Notare, sogar der Bezirksgouverneuer war dabei, ein typischer Barranquillero, der als Konservativer seine eigene Art zu urteilen und zu regieren hatte. Einige Gäste gingen nach Mitternacht, und der Rest verkrümelte sich allmählich, bis nur Alfonso, Germán und ich mit dem Gouverneur zurückblieben, in einer Verfassung, die etwa so klar und vernünftig war wie die bei nächtlichen Feiern unserer frühen Jugend.
In den langen Gesprächen des Abends erhielt ich eine überraschende Lektion über Wesen und Haltung jener, die in den blutigen Jahren die Stadt regierten. Der Gouverneur meinte, eine besonders beunruhigende Folge dieser barbarischen Politik sei die ungeheure Zahl von Flüchtlingen, die in den Städten weder Bett noch Brot hatten.
»Bei dieser Gangart«, schloss er, »wird unsere Partei mit Unterstützung der Armee bei den nächsten Wahlen keine Gegner mehr haben und damit die absolute Macht.«
Barranquilla war die einzige Ausnahme, weil es hier eine Kultur des politischen Zusammenlebens gab, von der auch die Konservativen geprägt waren, was die Stadt zu einem friedlichen Zufluchtsort im Auge des Hurrikans gemacht hatte. Ich wollte ethische Argumente vorbringen, doch er stoppte mich mit einer Handbewegung.
»Pardon«, sagte er, »das bedeutet nicht, dass wir außen vor sind. Ganz im Gegenteil, gerade unser Pazifismus hat dazu geführt, dass sich das soziale Drama des Landes bei uns durch die Hintertür eingeschlichen hat. Es ist mitten unter uns.«
So erfuhr ich, dass fünftausend Flüchtlinge aus dem Landesinneren im größten Elend in die Stadt gekommen waren und man nicht wusste, wie man sie eingliedern oder verstecken sollte, damit das Problem nicht öffentlich wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt gab es Militärpatrouillen, die an den kritischen Stellen Wache hielten, und jedermann sah sie, doch die Stadtoberen stritten ihre Präsenz ab, und die Zensur verhinderte, dass die Presse darüber schrieb.
Bei Tagesanbruch, nachdem wir den Herrn Gouverneur ins Auto hatten schleppen müssen, gingen wir ins Chop Suey, den Frühstücksladen der großen Übernächtigten. Alfonso kaufte an
Weitere Kostenlose Bücher