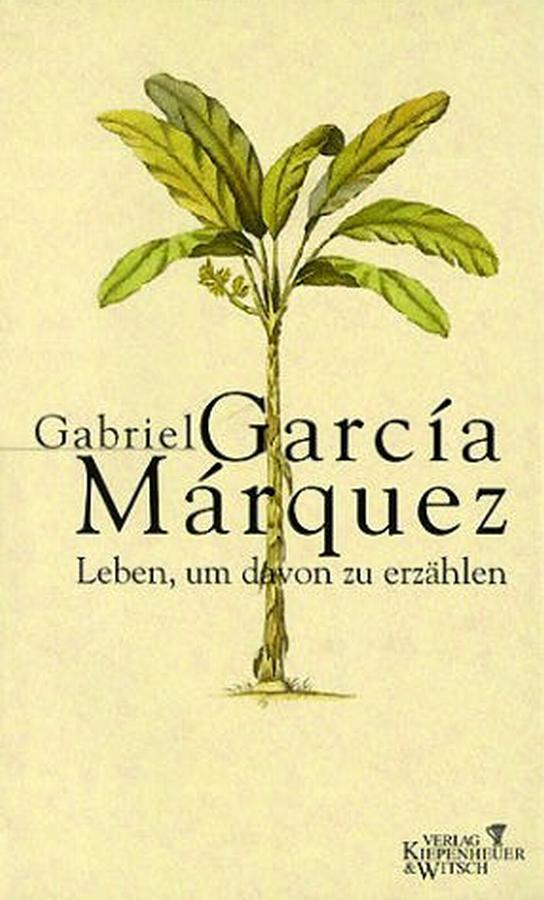![Leben, um davon zu erzählen]()
Leben, um davon zu erzählen
drei sorgfältig in grüner Tinte ausgeführten Rechtschreibkorrekturen.
Der tägliche Lohn reichte gerade nur, um das Zimmer zu bezahlen, doch in jenen Tagen machte mir dieser Abgrund von Armut noch am wenigsten Sorgen. Wenn ich, wie so oft, kein Geld für das Zimmer hatte, ging ich ins Café Roma zum Lesen und wirkte wie ein einsamer Herumtreiber in der Nacht des Paseo Bolívar, was ich ja auch war. Sah ich irgendeinen Bekannten, grüßte ich ihn von fern, wenn ich ihn denn überhaupt eines Blicks würdigte, und ging weiter bis zu meinem Stammplatz, wo ich oft so lange las, bis mich die Sonne verscheuchte. Denn ich war immer noch ein unersättlicher Leser ohne jede systematische Bildung. Vor allem las ich Lyrik, auch schlechte Lyrik, da ich sogar in der schlimmsten Verfassung davon überzeugt war, dass schlechte Poesie früher oder später zu guter führt.
Meine »Jirafa«-Kolumnen verrieten ein Gespür für die Volkskultur, ganz im Gegensatz zu meinen Erzählungen, die wie kafkaeske Rätsel wirkten, geschrieben von einem, der nicht wusste, in welchem Land er lebte. Die Wahrheit war jedoch, dass das Drama Kolumbiens nur wie ein fernes Echo mein Herz erreichte und mich nur bewegte, wenn es sich in Strömen von Blut offenbarte. Ich zündete eine Zigarette an der anderen an und sog den Rauch so lebensgierig ein wie ein Asthmatiker die Luft. Die drei Päckchen, die ich täglich rauchte, waren meinen Nägeln anzusehen, und ich hustete in meinen jungen Jahren qualvoll wie ein alter Köter. Kurz, ich war schüchtern und traurig wie jeder gute Karibe und wachte so eifersüchtig über mein Innenleben, dass ich jeder Frage dazu eine rhetorische Abfuhr erteilte. Ich war davon überzeugt, dass mein Pech angeboren und unheilbar war, besonders was Frauen und Geld betraf, aber das war mir egal, da ich glaubte, Glück sei nicht nötig, um gut zu schreiben. Ich dachte nicht an Ruhm, noch an Geld oder an das Alter, weil ich sicher war, jung und auf der Straße zu sterben.
Die Reise mit meiner Mutter nach Aracataca rettete mich vor diesem Abgrund, und die Gewissheit des neuen Romans wies mir am Horizont eine andere Zukunft. Unter den vielen Reisen meines Lebens war diese eine die entscheidende, da ich dabei am eigenen Leibe erfuhr, dass das Buch, das ich zu schreiben versuchte, nur eine rhetorische Erfindung war, die sich auf keine dichterische Wahrheit stützen konnte. Als das Romanprojekt bei dieser lehrreichen Reise auf die Realität stieß, zerbrach es natürlich in tausend Stücke.
Als Modell für eine Saga, wie ich sie erträumte, konnte nur meine eigene Familie dienen, in der es keine Helden, ja nicht einmal Opfer gab, sondern in der alle immer nur nutzlose Zeugen und Leidtragende der Ereignisse waren. Noch in der Stunde meiner Rückkehr begann ich mit dem neuen Roman, ich wusste, es war sinnlos, bei der Darstellung mit artifiziellen Mitteln zu arbeiten, entscheidend war die emotionale Fracht, die ich, ohne es zu wissen, mit mir herumgeschleppt hatte und die im Haus der Großeltern unversehrt zum Vorschein kam. Mit dem ersten Schritt, den ich in den glühenden Sand des Dorfes tat, wurde mir klar, dass meine bisherige Methode keineswegs glücklich war, um von diesem irdischen Paradies der Verlassenheit und der Nostalgie zu erzählen, es kostete mich dann allerdings noch viel Mühe und Zeit, den richtigen Weg zu finden. Die Arbeitsbelastung durch Crónica, die vor dem Erscheinen stand, war kein Hindernis, sondern ganz im Gegenteil: Sie nahm meine Unruhe an die Kandare.
Außer Alfonso Fuenmayor - der mich wenige Stunden nach Schreibbeginn im schöpferischen Fieber überrascht hatte - glaubten alle anderen Freunde noch lange, dass ich weiter an La casa schrieb. Ich wollte das so, weil ich eine kindische Angst davor hatte, dass das Scheitern eines Projekts, von dem ich ständig wie von einem Meisterwerk gesprochen hatte, offensichtlich würde. Aber ich entschied mich dazu auch wegen des Aberglaubens, dem ich immer noch anhänge, dass es gut ist, eine Geschichte zu erzählen und an einer völlig anderen zu schreiben, damit man nicht weiß, welche welche ist. Vor allem bei Zeitungsinterviews, ein schillerndes Genre und gefährlich für schüchterne Schriftsteller, die nicht mehr sagen wollen, als notwendig ist. Germán Vargas muss jedoch mit seinem geheimnisvollen Scharfblick dahintergekommen sein, weil er einige Monate nach Don Ramóns Abreise an diesen schrieb: »Ich glaube, dass Gabito das Projekt La casa aufgegeben hat und
Weitere Kostenlose Bücher