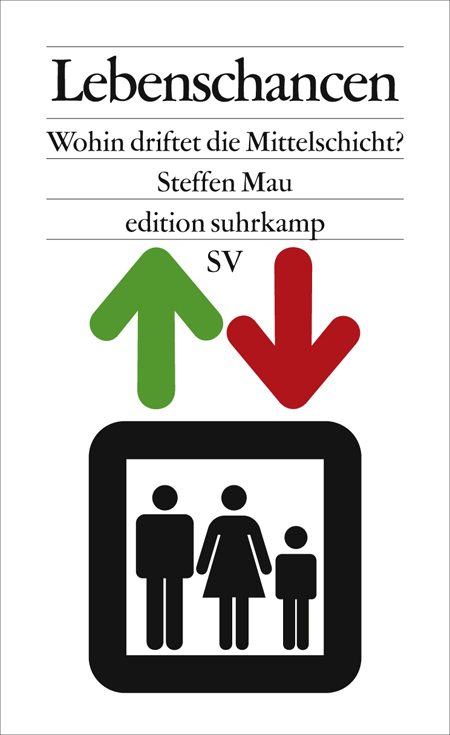![Lebenschancen]()
Lebenschancen
Neidfreiheit anzunähern. Sie setzen auf ein System der Verteilung von Gütern, das durch Offenheit und Chancengleichheit gekennzeichnet ist, wodurch der legitime Neid minimiert werden kann. Für eine Gesellschaft besteht immer dann Anlass zur Sorge, wenn Neid dort entsteht, wo es einen (wahrgenommenen) Mangel an ausgeglichenen Startbedingungen und Kritik an basalen Verteilungsprinzipien gibt. Der Ausdruck » justified envy « bezieht sich selten ausschließlich auf konkrete Objekte (Konsumgüter oder gehobene Positionen), sondern vielmehr darauf, wie Menschen zu ihrer privilegierten Stellung gekommen sind.
Die Perspektive erweitert sich, wenn wir fragen, was eigentlich die Zufriedenheit mit dem eigenen Status und einer bestimmten Wohlstandsausstattung ausmacht. Hier wissen wir, dass Statuszufriedenheit vom sozialen Kontext abhängt: Wer sich arm oder reich fühlt, lässt sich nicht allein anhand objektiver Kriterien ermitteln. Context matters , es kommt immer auf den Kontext an: Wir brauchen Zusatzinformationen, um uns eine Einschätzung zuzutrauen: In welcher Gesellschaft lebt diese Person? Wie groß ist der durchschnittliche Wohlstand? Wie ist dieser verteilt? Menschen würden lieber in einer Gesellschaft leben, in der sie 1800 Euro verdienen und in der das durchschnittliche Einkommen bei 1000 Euro liegt (Gesellschaft A), als in einer mit einem Durchschnittsverdienst von 3000 Euro, in der sie selbst 2000 Euro nach Hause bringen (Gesellschaft B). Rein finanziell gesehen, sind sie in Gesellschaft B besser gestellt, rela
tiv gesehen jedoch in Gesellschaft A, und deshalb geben sie ihr den Vorzug. In der Forschung gibt es seit vielen Jahren einen weithin anerkannten und immer wieder bestätigten Ansatz zur Bewertung der eigenen sozialen Lage, die Theorie der relativen Deprivation von Walter G. Runciman (1966). Runciman konnte zeigen, dass die Einschätzung der eigenen Situation weniger mit dem absoluten Status zu tun hat als vielmehr mit dem Vergleich mit bestimmten Referenzgruppen. Erst letztere liefern einen Ankerpunkt für das Gefühl der Besser- oder Schlechterstellung. Dabei sind Aufwärtsvergleiche wichtiger als Abwärtsvergleiche.
Die Implikationen dieses Konzepts sind vielfältig. Es hilft uns auch zu verstehen, warum manche Personen trotz vergleichsweise hohen Wohlstands unglücklich über ihren Lebensstandard sind und weshalb objektiv arme Menschen mit bescheidenem Wohlstand durchaus zufrieden sein können. In beiden Fällen hängt die Einschätzung und Zufriedenheit mit dem, was man hat, an der Wahl der Referenzgruppe. Menschen in armen Regionen vergleichen sich mit Nachbarn und Freunden, europäische Mittelschichtler mit eher gehobenen Wohlstandsgruppen. Runciman war aber nicht so naiv zu glauben, dass alle Menschen sich permanent miteinander vergleichen. Arme Menschen denken keineswegs unablässig darüber nach, wo sie in der sozialen Hierarchie stehen und ob sie ihren gerechten Anteil erhalten. Er geht davon aus, dass Individuen, die ohnehin keinen Anlass haben, auf mehr zu hoffen, nicht unbedingt unzufrieden sind mit den Gütern, den Chancen und dem Einkommen, über die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügen. Wer einen Hauptschulabschluss hat, wird einem Professor seine Position kaum neiden. Es kommt also auf die Vergleichswürdigkeit an.
Runcimans Theorie ist in der Folge in vielerlei Hinsicht verfeinert worden. So wissen wir heute beispielsweise mehr über die Referenzgruppen. Individuen vergleichen sich nicht nur mit Angehörigen sozial naher Gruppen (wie etwa dem Freundeskreis), sondern auch mit der Elterngeneration oder Menschen
in anderen Ländern. Die Erinnerung an den eigenen Status in früheren Lebensphasen spielt ebenfalls eine Rolle. Runciman selbst unterschied bereits zwischen egoistischer und fraternaler Deprivation. Ersteres meint, dass eine Person sich gegenüber Menschen aus der eigenen Bezugsgruppe benachteiligt fühlt; fraternale Deprivation bedeutet, dass ganze Gruppen sich als benachteiligt empfinden, wobei dieser Eindruck sich auf Rechte, Status oder Wohlstand beziehen kann.
Wenn also die Mittelschicht kollektiv von Statusangst befallen wird, handelt es sich um einen Fall fraternaler Deprivation. Tatsächlich zeigen Umfragedaten, dass in dieser Schicht der Eindruck zunimmt, Leistung werde nicht gerecht entlohnt, man bekomme nicht länger den verdienten Anteil vom Kuchen (Liebig/Schupp 2008). Jürgen Schupp unterstreicht: »Die Zunahme gefühlter Einkommensungerechtigkeit
Weitere Kostenlose Bücher